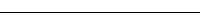von Mortimer Mertens
Einleitung
Die vorliegende Arbeit widmet sich der historischen Untersuchung der sogenannten Siegplatte in Siegen. Ziel ist es, durch gezielte Recherchen im Stadtarchiv herauszufinden, wann, aus welchen Gründen und auf wessen Veranlassung dieses Bauwerk errichtet wurde. Die Siegplatte stellt ein, für die Zeit, bedeutendes städtebauliches Projekt dar, dessen Geschichte eng mit den Entwicklungen in der Verkehrsinfrastruktur und den Mobilitätstrends der 1960er Jahre in Deutschland verknüpft ist.
Zuerst wird eine grundlegende Beschreibung der Siegplatte vorgenommen, um das Bauwerk und seine Funktion im städtischen Raum zu verorten. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern die Errichtung der Siegplatte Ausdruck der Bestrebungen war, Siegen in eine "autogerechte Stadt" zu transformieren. Diese Perspektive wird in den Kontext deutschlandweiter Mobilitätstrends sowie spezifischer Veränderungen im öffentlichen Personennahverkehrs in Siegen beleuchtet.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den beteiligten Akteuren des Bauvorhabens. Hierbei sollen die im Stadtarchiv zugänglichen Informationen zu den ausführenden Bauunternehmen und der Ausschreibung analysiert werden.
Zudem soll eine Analyse beziehungsweise Einordnung möglicher Berichterstattungen in der zeitgenössischen Presse Teil der Arbeit sein. Abschließend werden die offizielle Eröffnung der Siegplatte und die mediale Berichterstattung dazu beleuchtet.
Diese Arbeit soll ein Beitrag zur städtebaulichen Geschichtsforschung Siegens sein. Die Siegplatte soll als Beispiel für die Wechselwirkungen zwischen urbaner Planung, Mobilitätskultur und gesellschaftlichen Transformationsprozessen im 20. Jahrhundert untersucht werden.
Die Siegplatte
Als Siegplatte bezeichnet man das städtebauliche Bauwerk, welches zwischen 1967-1968 in der Siegener Innenstadt errichtet wurde. Dabei handelt es sich um eine 5100m² große Fläche, welche auf einer Überkranung der Sieg geschaffen wurde. Das Bauwerk überspannte die Sieg zwischen der Hindenburgbrücke und der Bahnhofstraße. Sie wurde hauptsächlich, aber nichts ausschließlich, als KFZ-Parkanlage genutzt und wurde im Laufe der Zeit als Symbol für den Trend der autogerechten Stadt angesehen. Die Platte diente auch als Veranstaltungsfläche, unter anderem für Weihnachtsmärkte und Feste.[i]
Über die Spezifikationen des Bauwerks schreibt die zeitgenössische Presse folgendes:
„Die Parkanlage besteht aus 2600cbm Beton und 450t Baustahl, sie ruht auf 56 Stützen die zum Teil 8 m tief ins Erdreich eingelassen werden mussten. Auf einer Parkfläche von rund 5100m² haben 230 Personenwagen Platz. 15 Doppelleuchten sorgen auch in der Dunkelheit für gute Sicht. Der Parkplatz ist durch 13 Hochbeete verschönert worden. Für das Siegbett wurden 11000cbm Erde bewegt und auf einer Fläche von 12000cbm 190000 Doppelverbund-Pflastersteine verlegt, ein Projekt das in dieser Größe einmalig im Bundesgebiet ist. Das Siegufer wurde mit 150t Stahlspundbohlen für die nächsten Jahrzehnte vor dem Verfall gesichert.“[ii]
Alleine durch ihre Größe war die Siegplatte somit ein markantes Wahrzeichen der Stadt. Wenn man von der Unterstadt in die Oberstadt ging, musste man Sie überqueren. Zudem entwickelte sie sich schnell zum meist frequentierten Parkplatz der Stadt.[iii]
Verkehrswende in Deutschland 1960er Jahre
In den 1960er Jahren nahm der Individualverkehr in Deutschland stark zu. Dies wurde durch verschiedene Faktoren beeinflusst:
- Die Expansion des Autobahnnetzes
- Das fortschreitende Wirtschaftswunder
- Das wachsende Angebot an Automobilen
- Eine zunehmende Motorisierung der Bevölkerung
- Steuerliche Anreize[iv]
Auf Grund der zunehmenden Motorisierung der Bevölkerung erreichten bald auch erste Probleme des motorisierten Individualverkehrs die Städte. Um die Dimensionen aufzuzeigen hier eine kurze Einordnung der Entwicklung:
„Allerdings stieg mit dem steigenden Bestand auch die Not an Parkflächen. Insbesondere die Zahl gewerblich zugelassener Fahrzeuge wuchs rasch. 1960 betrug der Bestand schon 4,5 Millionen Pkw, 1965 wurden fast 10 Millionen Wagen gezählt.“[v]
Diese Verdopplung des Verkehrsaufkommens war eine Herausforderung für die Städte und Kommunen und veränderten das Stadtbild. Allerdings war öffentlicher Parkraum damals anders reguliert als heute.
Fahrzeuge mussten aufgrund einer Verordnung über Nacht auf privaten Flächen abgestellt werden. Dementsprechend fanden sich keinerlei bis wenige Autos langfristig auf öffentlichen Flächen, wie den Straßenrändern und die Städte mussten sich weniger mit der Schaffung von Parkflächen beschäftigen. Wenn man heute durch die Straßen geht, sind die Straßenränder voll. Das liegt unter anderem daran, das Pkw rund 23 Stunden am Tag parken.[vi] Viele davon als Dauerparker, die mehrere Tage nicht bewegt werden. Diesen Zustand gab es bis 1966 nicht.
Im Jahre 1966 wurde die Rechtsprechung vom Bundesverwaltungsgericht geändert. Autos durften fortan auch im öffentlichen Raum über Nacht abgestellt werden. Die Städte sahen sich dadurch mit dem grundlegenden Problem einer Neuregelung der öffentlichen Verkehrsflächen konfrontiert.
In der Folge mussten Städte den öffentlichen Raum neu gliedern und Lösungen für Autofahrer ausarbeiten. In Siegen haben wir dazu noch eine Besonderheit zu beachten. Von 1950 bis 1958 fand dort ein Umbruch im öffentlichen Nahverkehr statt. Die Siegener Straßenbahn, die „Elektrische“ genannt wurde und zwischen Siegen, Weidenau, Geisweid bis hin nach Kreuztal verkehrte, wurde stillgelegt und durch O-Busse ersetzt.[vii] Mit der Zunahme des Individualverkehrs war es vermehrt zu kleineren Zusammenstößen zwischen PKWs und der Straßenbahn gekommen. In der Folge Beschloss die Stadt Siegen den unflexiblen und an die Schiene gebundenen Verkehrsteilnehmer durch O-Busse zu ersetzen.[viii]
Somit sorgte das erhöhte Aufkommen an Autos zu einer Stilllegung der Straßenbahn und der Bedarf nach Individualverkehr bei Pendlern sowie Menschen die in die Stadt wollten um einzukaufen nahm zu. Vor diesem Hintergrund ist der städtebauliche Wunsch der Stadt Siegen nach innerstädtischen Parkflächen einzuordnen, wenn man sich mit dem Bau der Siegplatte beschäftigt.
Planung und Beauftragung
Doch wer beschäftigte sich und beschloss zu dieser Zeit städtebauliche Verkehrsflächen wie der Siegplatte in Siegen?
Dieser Frage wollen wir uns im folgenden Absatz widmen. Dem Beschluss zum Bau der Siegplatte sind einige Vorplanungen vorangegangen. So wurde nach einem ersten Entwurf der Siegplatte eine Untersuchung der Sieg in Auftrag gegeben. Ziel war es zu überprüfen, ob der Fluss bei Hochwasser trotz der Überbauung in der Lage wäre die von der Wasserwirtschaft Hagen errechneten Wassermangen abzuführen.[ix]
Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in Bezug auf die Pläne für die Überkranung der Siegplatte durchaus interessant, da sie aufzeigen, dass die Sieg auch ohne Überbauung nicht dazu in der Lage war, die errechneten Wassermengen abzuführen. Die Stadt Siegen hatte folglich auch unabhängig von der Überkranung der Sieg Handlungsbedarf in Sachen Hochwasserschutz. „Im bestehenden Zustand kann die Sieg wegen der starken Ungleichförmigkeit des Bettes und des mangelhaften Abflussprofils die unter 1,2 genannten Wassermassen nicht abführen. Der Einbau der zwei, im Entwurf der Fa. Runkel vorgesehenen Pfeilerreihen mit je 40 cm o/ ergibt keine wesentliche Veränderung der Verhältnisse.“[x]
Basierend auf der beschriebenen Untersuchung, erstellten Dipl. Ing. Kadereit und Dipl. Ing. Gruhle im Auftrag der Stadt Siegen ein Modell der Sieg und des Siegufers, anhand dessen neue Konzepte und Gestaltungen der Siegsohle berechnet und geprüft werden konnten. Am Ende der Sondierung kristallisierte sich der Bau einer Niedrigwasserrinne zur Abwendung der Hochwassergefahr als beste Lösung heraus, der zugleich den Bau der Siegplatte ermöglichte.
Deshalb wurde in den Untersuchungen von Dipl. Ing. Kadereit und Dipl. Ing. Gruhle ein Modell der Sieg und des Siegufers gebaut anhand dessen neue Konzepte und Gestaltungen der Siegsohle berechnet und geprüft werden konnten. Am Ende kristallisierte sich die Lösung heraus eine Niedrigwasserrinne zu bauen um die generelle Gefahr eines Hochwassers abzuwenden und die Siegplatte bauen zu können.
„Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Überbauung der Sieg, wenn sie zusammen mit einer Regelung der Abflussverhältnisse durchgeführt wird, die Abflussverhältnisse in der Ausbaustrecke verbessert und Behinderungen des Hochwassers in der Sieg nicht zu befürchten sind.“[xi]
Den Beschluss zum Bau der Siegkranung erteilte der Siegener Bauausschusses in seiner Sitzung am 29.03.1967.[xii] Interessant dabei ist, dass explizit der Bau von Parkplätzen als Grund für den Beschluss genannt wird, obwohl es auch ohne den Bau der Siegplatte durchaus zu umfangreichen Arbeiten an der Siegsohle hätte kommen müssen.
Doch welches Bild lässt sich bei einer Analyse der Ausschreibungsunterlagen der Siegplatte ableiten?[xiii] Um das zu bewerten müssen wir in eine kurze Analyse der Ausschreibung des Tiefbauamtes einsteigen. Die Arbeiten wurden in einzelne Lose aufgeteilt und dementsprechend ausgeschrieben.
In den Losen werden die baulichen Spezifikationen erläutert.
Danach werden die rechtlichen Parameter festgehalten. Punkte wie Vergütung, die Erstellung von Ausführungsunterlagen, Ausführungsfristen aber auch die Lage der Baustelle.
Die Stadt Siegen hat unter anderem folgende Punkte in der Ausschreibung festgehalten:
- Alle Preise sind Festpreise
- Die gesamte Leistung soll von einem Auftragnehmer ausgeführt werden, die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft ist aber zulässig solange ein Mitglied gegenüber Stadt als Vertreter der Gemeinschaft benannt wird.
- Die Gesamtleistung muss durch die Stadt bis zum 10.11.1968 in Betrieb genommen werden können.
- Strafzahlung bei Verzug sowie Beschleunigungsvergütung bei früherer Fertigstellung.
Ob der Ausbau der Sieg Bestandteil der baulichen Spezifikationen war, muss folglich in Punkt 1 der Ausschreibungsunterlagen, den vier Losen, untersucht werden.
In Punkt 1 der Ausschreibungsunterlagen geht es um die verschiedenen ausgeschriebenen Leistungen sowie den Bau und die Spezifikationen der Siegkranung. Die im Modellversuch gewonnen Erkenntnisse rund um den Hochwasserschutz finden sich in Los 1 der Ausschreibung wieder. Sie sind in den Ausbauarbeiten der Sieg eingearbeitet und somit die Grundlage der nachstehenden Bauarbeiten. Ansonsten ist in der Ausschreibung das Thema Wasser bzw. der Ausbau der Sieg kein Thema und findet keine Erwähnung. Dennoch kann man festhalten, dass nicht nur der Bau von Parkplätzen ausgeschrieben wurde. Vielmehr waren hier durchaus sicherheitsrelevante städtebauliche Arbeiten Bestandteil der Siegplatten Ausschreibung sowie der späteren Umsetzung.
Die Bauträger
In den Akten des Stadtarchives Siegen findet sich das Angebot einer Bietergemeinschaft. Teil dieser sind die Firmen Benno Drösser KG, Otto Quast und Christian Runkel. Für die Pfahlgründung in der Sieg wird die Firma de Waal als Nachunternehmer vorgestellt.
Bis auf die Firma de Waal haben sich somit 3 nationale, lokale Bauunternehmer und Ingenieure zusammengetan. Die Firma Otto Quast und Benno Drösser agieren auch heute noch unter gleichem Namen. Im Angebot wird alles so angeboten, wie in der Ausschreibung erwähnt. Jedoch gibt es eine Abweichung die direkt ins Auge fällt. Die Unternehmen präferieren eine andere Materialbeschaffenheit der Siegsohle.[xiv]
Um die Wasserqualität zu verbessern wurden sogenannte Höckerpflaster für die Siegsohle ausgeschrieben. Diese sollten zu mehr Sauerstoff im Wasser führen sowie die Fließgeschwindigkeit reduzieren.[xv] Die Bauunternehmen wollten aber mit dem Sondervorschlag 3, welchen sie im Angebot erläutern, großflächige Elemente auf der Siegsohle verlegen. Als Grund für ihren Vorschlag nennen Sie die einfachere Instandhaltung. Dieser Vorschlag wurde nicht übernommen, sondern wie ursprünglich vorgesehen mit Höckerpflastern gearbeitet.
Den Zuschlag für den Bau erhielten dennoch die genannten Anbieter.
Bezüglich des engen Zeitrahmens, den die Stadt Siegen im Angebot gesetzt hat, empfehlen die Bauunternehmer die Verwendung von Betonfertigteilen. Auch weisen Sie bezüglich der Bauarbeiten im Flussbett darauf hin, dass es im Sommer durchaus zu Witterungstechnischen Verzögerungen kommen kann.[xvi] Die Bauarbeiten verliefen in der Tat nicht ohne Probleme. So behinderten im Sommer 1968 starker Regen und Unwetter die Arbeiten mehrfach.[xvii] Es sollen sogar einmal Material und Maschinen nach einem Unwetter weggeschwemmt worden sein. Dennoch wurde die Siegplatte ohne große Verzögerungen an die Stadt Siegen übergeben.[xviii]
Mediale Berichterstattung
Im Stadtarchiv der Stadt Siegen finden sich unzählige Zeitungsberichte über den Fortschritt der Arbeiten rund um die Siegplatte. Auf sie alle einzeln einzugehen, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und bietet keinen echten Mehrwert, weshalb an dieser Stelle exemplarisch aufgezeigt werden soll, wie die Berichterstattung verlief.
Schon zu den Untersuchungen der Siegsohle im Jahr 1967 gab es einen Artikel in der Siegener Zeitung.[xix] Darüber hinaus existieren weitere Artikel und Berichte aus der Siegener Zeitung, welche die Bauarbeiten beinahe minutiös wiedergeben. Ob es die „Betonierarbeiten an den Unterzugbalken“[xx] oder die Kranarbeiten sind, welche die 13 Tonnen schweren Träger „nahezu behutsam“ über das Flussbett legen[xxi], die Siegener Zeitung berichtet dazu. Man kann also schlussfolgern, dass das Interesse der Siegenerinnen und Siegener an den Bauarbeiten groß war. Ansonsten hätte man die Seiten wohl mit anderen Artikeln gefüllt.
Besonders zum Ende der Arbeiten nehmen die Berichte nochmal zu. So bewerben Einzelhandel und Stadt die Siegplatte und priesen die Vorzüge der neuen Parkmöglichkeiten. „230 neue Parkplätze: Siegen jetzt noch sympathischer“ titele die Siegener Zeitung unter anderem Ende November 1968 und pries die unternehmerische Leistung der Planer, Baufirmen und Ingenieurbüros.[xxii] Vor allem mit der Formulierung „Mein Auto schwebt über der Sieg“ hatte die Stadtverwaltung das Bauwerk zur Fertigstellung beworben.[xxiii]
Fazit
Mit dem Slogan „Mein Auto schwebt über der Sieg“ wird die Funktion und die Nutzung des Siegplatte in den Kontext der damaligen Zeit gestellt. Selbst wenn zu Beginn der Arbeiten auch der Hochwasserschutz eine Rolle spielte, ist die Siegplatte als solches ein rein funktionaler Bau. Es ist ein städtebauliches Zeugnis für den zunehmenden Individualverkehr und eine Veränderung in den Gewohnheiten der Menschen hin zum Auto.
Doch auch die Änderung der öffentlichen Parkordnung und der politische Wille führte zu einer Veränderung im Parkverhalten welches in der Arbeit beleuchtet wird.
Damit haben wir den Grund für den Bau der Siegplatte gut umrissen. Es zeigt sich dabei, dass Mobilitätstrends das Gesicht einer Stadt prägen können und in diesem Fall auch geprägt haben. Einen besonderen Treiber für die Arbeiten innerhalb der Siegener Bevölkerung oder Regierung konnte in den Recherchen allerdings nicht gefunden werden. Das am Ende der Bauausschuss das Vorhaben genehmigte, liegt wohl vor allem an der Verteilung der Kompetenzen innerhalb der Stadtpolitik.
Dass dies nicht alternativlos ist, sieht man an der Neugestaltung des Siegufers und dem Abbruch der Siegplatte 2012. Es bleibt abzuwarten, welche neuen städtebaulichen und mobilitätspolitischen Veränderungen wir in der Zukunft erleben werden.
(2025)
[i] Vgl. Behördendrucksachen, Öffentlichkeitsarbeit Siegen zu neuen Ufern - Siegen pulsiert, Stadtarchiv Siegen, 1975.
[ii] Siegener Zeitung, 29.11.1968, Artikel, Stadtarchiv Siegen, 258.
[iii] Vgl. Siegener Zeitung, 30.08.2008, Artikel, Stadtarchiv Siegen, 646.
[iv] Vgl. Karl-Heinz Rothenberger: Auto, Straße und Verkehr: Kraftfahrzeug und Straßenverkehr in der Pfalz von den Anfängen des Automobils bis in die Gegenwart, BoD, Norderstedt, 2014, S. 65ff.
[v] Andreas Knie: Deutschlands Weg in die Automobilgesellschaft. Verkehrspolitik im Schatten des NS, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 73, 51-52 (2023), S. 9-15, hier S. 14.
[vi] Vgl. Martin Randelhoff: Die größte Ineffizienz des privaten Pkw-Besitzes: Das Parken, in: Zukunft Mobilität, Strassenverkehr, 23.02.2013, https://www.zukunft-mobilitaet.net/13615/strassenverkehr/parkraum-abloesebetrag-parkgebuehr-23-stunden/ (19.02.2025).
[vii] Vgl. Andreas Goebel: So prägte die Straßenbahn das Siegener Stadtbild, in: Siegener Zeitung, Siegen, 29.05.2022, https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/letzte-fahrt-vor-70-jahren-so-praegte-die-strassenbahn-das-siegener-stadtbild-AGS5CR5SG7RZDBM4WG2SZJ4Z77.html (19.02.2025).
[viii] Vgl. Adolf Müller: Unser Krönchen. Bd. 1: Streifzug durch die lange Vergangenheit des Siegener Lebens, 1. Auflage, Siegen 1983, S. 175ff.
[ix] Vgl. Modellversuch für die Überbauung der Sieg – Zwischenbericht, 16.05.1967, Zwischenbericht nach Abschluss der Voruntersuchung, Stadtarchiv Siegen, 66, 4716.
[x] Modellversuch für die Überbauung der Sieg – Zwischenbericht, 16.05.1967.
[xi] Modellversuch für die Überbauung der Sieg – Zwischenbericht, 16.05.1967.
[xii] Vgl. Niederschrift Bauausschuss, 29.03.1967, Beschluss zum Bau der Siegplatte, Stadtarchiv Siegen, 3108.
[xiii] Vgl. Ausschreibung für die Siegregulierung und ihre Überbauung, 1967, Beschreibung des Vorhabens inkl. der Lose, Stadtarchiv Siegen, 66, 4718.
[xiv] Vgl. Angebot der Bietergemeinschaft, 25.03.1968, Angebot zur beschränkten Ausschreibung für die Überbauung der Sieg in Siegen, Stadtarchiv Siegen, 66, 4726.
[xv] Vgl. Siegener Zeitung, 08.07.1968, Artikel, Stadtarchiv Siegen, 257.
[xvi] Vgl. Angebot der Bietergemeinschaft, 25.03.1968.
[xvii] Vgl. Siegener Zeitung, 13.09.1968, Artikel, Stadtarchiv Siegen, 257.
[xviii] Vgl. Siegener Zeitung, 29.11.1968.
[xix] Vgl. Siegener Zeitung, 31.10.1967, Artikel, Stadtarchiv Siegen, 254.
[xx] Siegener Zeitung, 15.08.1968, Artikel, Stadtarchiv Siegen, 257.
[xxi] Vgl. Siegener Zeitung, 13.09.1968.
[xxii] Vgl. Siegener Zeitung, 29.11.1968.
[xxiii] David Schmidt: Besser als verlieren, in: Zeit Online, Reisen, 20.10.2014, https://www.zeit.de/reisen/2014-10/siegen-unterschaetzte-stadt (19.02.2025).