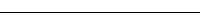von Marie Trybula
Als ich damals selbst den Alten Evangelischen Friedhof an der Hardt entdeckte, geschah das spontan und komplett ungeplant. Heute gibt es im Internet – etwa bei Grevenbrück Aktiv – einige informative Artikel, aber damals galt der Friedhof noch als „Lost Place“ – ich fand später einen Eintrag auf einer Geocaching-Seite. Erzählt hatte man mir jedenfalls nicht davon und er galt auch sonst nicht als lokale Sehenswürdigkeit, oder auch Teil der Geschichte, hatte doch Grevenbrück was nicht katholisch war eher aus seinem kulturellen Gedächtnis gestrichen. Seit 2014 steht er unter Denkmalschutz, da er ein Zeugnis der industriellen Geschichte in Grevebrück ist.
Für katholische Grevenbrücker stellt der Teil Grevenbrücks um die Kirche und die Twiene herum, genannt Förde, das Herz des Dorfes dar. Tatsächlich erscheint Förde sehr ruhig, ländlich, von alten Fachwerkhäusern und Apfelbäumen geprägt, als ein wohlhabendes Dorf. Geht man aber von hier nach Norden, stößt man bald auf die 1861 fertiggestellte Ruhr-Sieg-Strecke, die bis heute durch die Berge des Sauerlandes führt und Siegen mit dem Ruhrgebiet verbindet. Geht man nicht über den parkwegartigen Pfad vorbei an der Pferdewiese, Schauertes Fabrik, den Feldern und dem Denkmal für die Kriegstoten, sondern über die Hauptstraße zur Johannisbrücke, wird man bald sehen, wie villenartige Häuser und hohe, schattige Bäume die Fachwerkhäuser ablösen. Schließlich wird man auf den Bahnhof und die Lenne stoßen, auf die Bahnstrecke, die Kreuzung der B 55 und der B 236, auf Discounter, Läden, und den Streifen mit Fabriken, der sich durch das gesamte Lennetal zieht, als wäre er ein Ausläufer des Ruhrgebietes. Alles das ist Folge der Industrialisierung, die mit der Bahnstrecke endgültig nach Grevenbrück kam – man denke etwa an die Chemiefabrik, in welcher der in Meggen abgebaute Schwefelkies zu Schwefelsäure verarbeitet wurde, ein Prozess, der die Gegend mit Gestank überzog und das Wachstum der umgebenden Vegetation hinderte. Eine andere Folge dieser Entwicklung war die Entstehung einer evangelischen Minderheit in Grevenbrück, hierunter Eisenbahner und Unternehmer. Noch weiter nördlich des Gürtels von Eisenbahn und Industrie, der sie mitgebracht hatte, stößt die Bundesstraße auf eine steile Formation in der Landschaft – die Hardt – an der sie sich wieder teilt – die B 55 wendet nach Osten in Richtung Elspe, die B 236 Richtung Finnentrop unter dem steilen Hang. Wie eine Festung erhebt sich die Hardt steil und trocken über der Lenne und der Straße. Unter dem dichten Bewuchs aus noch recht jungen Bäumen, teils dornigen Büschen und üppigen Waldkräutern mag man beeindruckende Dolomitfelsen entdecken, verhüllt hinter Vorhängen aus Efeu. Der Rest der Hardt ist inzwischen leider durch den Grevenbrücker Steinbruch ausgehöhlt, den Laubwald mit den Maiglöckchen, den Ruhebänken, dem „Liebespfad“, der hier mal war, hat er verschlungen. Aber an einer übrig gebliebenen Felsformation, halb verhüllt vom Efeu, führt noch ein steiler Pfad die Hardt empor, der schon bald an einer Mauer vorbeiführt, dem Anfang eines geheimnisvollen Ortes …
Einst im Spätsommer entdeckte ich den Friedhof. Ich fand ihn völlig ungeplant – geht man nämlich von Trockenbrück aus auf das Wietfeld hoch (das ist das Plateau mit fruchtbarer, kalkhaltiger Erde, das an die Hardt anschließt), in Richtung der Hespecker Linde, erscheint bald zur linken ein Feldweg, der von üppigen Hecken gesäumt ist und in einem wild scheinenden Waldstück endet. Da mich etwas derartiges interessiert, (und in jüngeren Jahren noch mehr interessiert hat) bog ich auf diesen Feldweg ab (hier führt kein offizieller Wanderweg entlang) und schritt den Weg ab. Weiden und Wiesen wechselten mit wilden und hohen Schwarzdornhecken, in denen sich immer wieder alte Apfelbäume fanden, auf einer (nunmehr entfernten) Schutthalde blühten Schafgarben. Weiter führte der Weg in ein Waldstück herein, in dem zur Linken Bienenstöcke abgestellt waren. Bemerkenswert war aber, was geradeaus zu sehen war – ein schwarzer Obelisk glänzte zwischen Eschen und Birken – bestimmt ein Denkmal – dachte ich. Also nichts wie hin und nachsehen. Nach einigen Schritten fand ich mich auf einem Friedhof wieder – warum nur war er so abgelegen? Waren die Toten unliebsam gewesen, so mein erster Gedanke. Aber dann sah ich das die – schönen und prachtvollen Grabsteine Lebensdaten aus dem 19. Jahrhundert trugen und Namen, wie sie niemand, den ich kannte, trug …
Seither hat es mich immer wieder zu diesem faszinierenden Ort gezogen. Der Friedhof steht auf einem künstlich angelegten Plateau, das von einer Stützmauer gesichert wird. Auf diese Weise war es möglich, ihn in die schönen Dolomitfelsenhänge, die sich an der Hardt finden, einzulassen. Der ursprüngliche Pfad hin zum Friedhof, windet sich daher auch am steilen Hang der östlichen Hardt, über der Johannesbrücke zwischen solchen Felsen empor. Sie entstanden im Zeitalter des Devon als Teil der Attendorn-Elsper Kalkdoppelmulde, damals noch ein Korallenriff, aus dem im Laufe der Zeit Kalkfelsen wurden. Oben angelangt, führt der eigentliche, schon zugewucherte Weg zu dem (im Westen gelegenen) Eingang des Friedhofes. Hier verbirgt heute üppiger Efeu eine in den Kalk eingelassene Platte aus schwarzem Granit, die Besucher darüber aufklärt, was sie nun betreten werden: Den Friedhof der „Familie Wilhelm Hüttenhein“. Der Friedhof wurde ja um 1880 – so steht es auf einer dort angebrachten Informationstafel – als privater Friedhof der Familie angelegt, was er auch bis 1920 blieb. Man steht nun in einem Laubwald, heute hauptsächlich aus nicht zu alten Eschen und Eichen. In der Mitte dominiert eine große, alte Buche das Plateau. Sie muss hier absichtlich gepflanzt worden sein. In Richtung Norden, gegenüber der Stützmauer, begrenzten Kalkfelsen den Friedhof, später würden hier im frühen und mittleren 20. Jahrhundert die Gräber weiterer evangelischer Familien Grevenbrücks hinzukommen. Auf dem grasbewachsenen Plateau, das sich im Frühling mit Teppichen verwilderter Krokusse bedeckt, steht der eigentliche Friedhof der Familie.
Zunächst – wer waren die Hüttenheins? Wilhelm Hüttenhein (1816-1895) stammte aus Hilchenbach. Als dritter Sohn des Gerbereibesitzers Herrmann Hüttenhein kam er 1840 nach Grevenbrück, um im Auftrag seines Vaters mehrere hundert Zehnter Lohe (einen für die Gerberei nötigen Rohstoff) zu erwerben. Zwecks Einlagerung pachtete er auch das Brückenhaus des Grafen von Fürstenberg. Da er die schöne Landschaft Grevenbrücks kennen und lieben gelernt hatte – besonders die Hardt hatte es ihm angetan – beschloss er sich niederzulassen. Er begann 1841 also mit dem Bau einer Lohgerberei, die ab 1850 einen Profit von 100 Talern einbrachte. So konnte die zunächst noch im Brückenhaus wohnende Familie in ein eigenes Wohnhaus umziehen, welches ein englischer Garten mit teils exotischen Pflanzen umgab. Wilhelm und Henriette Hüttenhein (1820-1899) geb. Zimmermann aus Buschhütten bekamen drei Kinder: Wilhelm (1852-1916), Emma (1854-?) und Marie (1860-1889). „Willy“ übernahm später den Betrieb, und baute ihn 1900 – da lohgegerbtes Leder nicht mehr gefragt war – in ein Elektrizitätswerk um, welches auch die gleislose Bahn im Veischedetal betrieb. Mit seiner Frau Lina (1858-1915), Tochter des Landrates Wissmann aus Marienburg im Westerwald war er ab 1882 verheiratet. Das Paar hatte drei Töchter: Erna, Lina (1886-1888) und Hildegard (1889-1977), sowie den Sohn Wilhelm (* und + 1894). Die meisten dieser Menschen würden ihre letzte Ruhe auf eben diesem Friedhof in ungewöhnlicher, umständlicher wie romantischer Lage finden. Die Stelle, an der er angelegt wurde, war der Lieblingsort Wilhelm Hüttenheins, schreibt sein Nachkomme, Rudolf Gericke. Da ihm besonders die lokalen Kalkfelsen gefielen und er sich besonders auch für Höhlen interessierte (er unterhielt sogar einen engen Kontakt zu Höhlenforscher Prof. Johann Carl Fuhlrott), musste die Hardt ihm als der ideale Ort für die letzte Ruhe erscheinen.
Und was genau gibt es hier zu sehen? Zwei Doppelgräber mit hohen Grabsteinen aus schwarzem Granit stehen in der nördlichen Reihe nebeneinander – hier findet sich der eben erwähnte Obelisk. Die Grabsteine und die Anordnung der Gräber sind sehr aufschlussreich. Auf dem älteren von beiden, der glattgeschliffene Obelisk, steht in Frakturschrift: „hier ruht Wilhelm Hüttenhein geb. am 22. März 1816 gest. am 17. Januar 1895“ sein Name und seine Lebensdaten prangen unübersehbar auf dem Grabstein, nehmen bis zu drei viertel der Fläche ein. Es folgt weiter unten ein Trennstrich und ein weiterer Schriftzug, der geradezu wie dazu gequetscht erscheint: „Henriette Hüttenhein geb. Zimmermann geb. 14. Juli 1820 gest. 8. Nov. 1899.“ Betrachtet man die Namen aufmerksam und vergleicht sie – vor allem mit dem Grabstein nebenan, den des Sohnes der beiden und ihrer Schwiegertochter, fällt auf, dass auf diesem die Inschriften für die Ehepartner die selbe Größe haben. Ebenso, wie der Grabstein der (Schwieger-)eltern ist der Grabstein des jüngeren Paares länglich und hoch, er ist in einer klassischeren Schriftart beschriftet und im Groben rechteckig. Geschwungene Linien des späten Jugendstils verliehen ihm eine schlanke, agile Jugendlichkeit. Der Stein ist aufwendig bearbeitet – es wechseln etwa glattere Flächen mit solchen, die gröber bearbeitet sind. Zudem ist oben ein Borte eingemeißelt, die ganz im Sinne des damals gängigen Jugendstils, ein pflanzliches Motiv darstellt: Eine Rosengirlande. Der Grabstein wird nicht vor 1916 erstellt worden sein, so wundert es nicht, dass hier schon ein Übergang in die geraden Linien des Art Deco zu sehen ist: Vierecke sind in die Borte eingearbeitet, zwei Linien säumen sie. Damals änderten viele Ereignisse das Denken der Menschen: Fordismus, Taylorisierung, Erster Weltkrieg, allzu schneller Umbruch, als dass man sich anpassen könnte und schwere, unsichere Lebensbedingungen (man denke nur an 1923) ätzten sich vereint in das Bewusstsein der Menschen. So wurde hieraus alles sanfte und romantische, der Zuneigung fähige, gefallen wollende vertilgt, es folgten der Ruf nach „Zackigkeit“, „Tempo“, „Mitmachen“ und auch „einem starken Führer“ – ein bisschen davon zeigt sich in den kaum merklich geometrisch werdenden Linien der Rosenborte, ihre endgültige Vollendung findet diese Entzauberung der Welt in den Gräbern des Paares Hildegard und Nikolaus, doch davon später mehr. Zunächst wollte ich ja nur die beiden Doppelgräber vergleichen. Neben der Rosengirlande zeigt das Grabmal ein weiteres Symbol: zwei ineinander gelegte Hände, an der Kleidung als die eines Mannes und einer Frau deutlich zu erkennen. Dieses Zeichen deutet – das ist nicht schwer zu entziffern – auf eine enge Verbundenheit der Partner hin – ja sogar so eng, dass sie den Tod noch überdauert. Die Partner, Wilhelm und Lina, die im Abstand von 10 Monaten verstorben sind, reichen sich noch auf dem Grabmal die Hand. Ihre Inschriften weichen in der Größe nicht ab, zudem gibt es keinen Trennstrich, zwischen beiden – so lautet die Aufschrift: „Lina Hüttenhein geb. Wissmann geb. 24. Juni 1858 gest. 9. April 1915 Wilhelm Hüttenhein geb. 19 November 1852 gest. 15. Juni 1916“ unter einem jugendstilartig verschnörkelten Strich darunter verbindet ein „Ruhet in Frieden!“ die beiden Verstorbenen. Das gesamte Grabmal spricht eine deutliche Sprache: Die Ranke aus Rosen – ummissverständlich ist die Rose bis heute als Liebessymbol bekannt – die ineinander geschlungenen Hände, das verbindende „Ruhet in Frieden“, alles deutet auf eine große Verbundenheit der Partner hin. Es deutet auch darauf hin, dass der Grabstein für das Paar auf einmal in Auftrag gegeben wurde, nachdem beide schon tot waren.
Was mich weiter beschäftigt, ist die Größe des Namenszugs von Henriettes Namen im Vergleich zu dem ihres Mannes, der den Grabstein dominiert. Was könnte dahinter stecken? Auf Quellen und Vermutungen bin ich angewiesen, also vermute ich mal …
Auf dem Alten Evangelischen Friedhof auf der Hardt mag der schwarze, etwas abgeflachte Obelisk auf seinem Sockel ungewöhnlich erscheinen, für die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen war er aber ein sehr vertrauter Anblick. Es war geradezu ein klassisch geformter Grabstein. Genau der selbe Obelisk begegnet gleich mehrfach Besuchern und Besucherinnen des Friedhofs Berlin-Schöneberg als Grabmal der Brüder Grimm. Jeder der Grabsteine ist auf die selbe Weise bearbeitet. Obgleich er hoch ist, ist er immer für ein Einzelgrab gedacht. Die ganze obere Hälfte nimmt die Inschrift „hier liegt Soundso geb. X. gest. Y“ ein. Man findet den selben Obelisk im jüdischen Friedhof in Schmallenberg gleich mehrfach. Nicht zuletzt ziert er – diesmal aus rotem Granit – das Grabmal eines Ägyptologen. Auch Fotos anderer jüdischer Friedhöfe in der Region, die Grabmäler aus dem 19. Jahrhundert beinhalten, bestätigen die Verwendung der Obelisken als Grabmal für einen Menschen. Die einzige Ausnahme, die ich gefunden habe, ist ein heller Obelisk auf dem Alten Evanglischen Friedhof Langenfeld. Er ist das Grabmal einer Familie namens Holzmann. Trennstriche grenzen die einzelnen Inschriften von einander ab. Die größte ist die einer Frau, Julie Holzmann und die unterste der vier Inschriften findet sich gar auf dem dafür nicht vorgesehenen Sockel des Obelisken. Weitere noch spätere Gravuren kann man an der Seite sehen. Es scheint, dass ursprünglich die Partner in zwei Einzelgräbern nebeneinander ruhen sollten – wie Hildegard und ihr Mann – aber entweder sie, oder ihr Sohn und ihre Schwiegertochter überlegten es sich anders. War es Zuneigung, oder eine Sparmaßnahme? Rudolf Gericke schreibt, 1895 – im Todesjahr von Wilhelm Sr. – verdrängte ein neues Verfahren in der Gerberei das Gerben mit Lohe. In Folge musste die Familie die Lohgerberei aufgeben und sich komplett umorientieren. So war die Umwandlung des Grabes in ein Doppelgrab mit einem Grabstein vielleicht ein sparsamer Trick – eine von vielen kleinen und großen Einsparungen, die es möglich machen, später eine große Summe zu investieren. Vielleicht hat Henriette selbst sogar die Idee gehabt. Und so könnte er sich ergeben haben, dieser komische Unterschied zwischen den Ehegatten, von denen einer 60 % der Fläche der Inschrift einnimmt, während sich die andere auf 40 % zusammenkauert – so könnte es zumindest gewesen sein. Es war der Ägyptenfeldzug Napoleons, der eine Begeisterung für Obelisken und andere ägyptische Symbole und Objekte in der Zeit des Klassizismus entfachte, die ohnehin schon von einer Begeisterung für alles erfasst war, was typisch antik war, oder zumindest dafür gehalten wurde.
Sicher eingebettet zwischen den beiden Doppelgräbern der Eltern und Großeltern ist das Einzelgrab von Erna Hüttenhein, die im zarten Alter von 17 Jahren verstorben war – vielleicht an einer Krankheit. Das zarte, schmale, dunkle Kreuz, das ihr Grabmal gewesen war, liegt zerbrochen auf dem Sockel aus rosafarbenen Granit. Eingraviert ist: „Erna Hüttenhein * 1883 + 1901 Gott ist die Liebe, ruhe in ihr“. Für Linas und Willys große Schwester gab es also ein richtiges Grab und der liebevolle Spruch auf dem Kreuz zeugt von der Zuneigung der Eltern zur Tochter, die hier nicht als lebenssatter Mensch auftritt, der in Frieden ruhen mag, sondern als tragische Tote, deren Tod bedauerlich ist. So gönnten die Eltern es ihr, im Jenseits besonders stark die Liebe Gottes zu erfahren, nachdem ihr Sarg neben dem Grab ihrer Großeltern in der Erde verschwunden war.
Gegenüber dieser Reihe mit Doppelgräbern der Eltern und Großeltern zeigt sich wiederum ein von unseren heutigen Friedhöfen grundsätzlich verschiedenes Bild, ein weiteres Fenster in die Vergangenheit: Man sieht eine Reihe mit Gräbern der Nachkommen der Paare, dabei fallen zwei kleine Grabsteine ins Auge, sowie ein Frauengrab. Auf einem kleinen, schlichten Grabstein steht auf einer Platte aus schwarzem Stein: „Willy Hüttenhein, * u. + 1894“. Östlich hiervon ist ein kleines, quaderförmiges Grabmal, nur aus einfacherem Kalk, eine ursprünglich auf ihm angebrachte Zierde – vielleicht ein Kreuz, oder vielleicht der in einem Artikel erwähnte gestohlene Engel – ist mit der Zeit abgegangen. Noch lässt sich die bereits verwitterte Inschrift lesen: In Frakturschrift steht: „Lina Hüttenhein, geb. 28. Feb. 1886 gest. […] 1888“. Heutzutage sucht man auf einem Friedhof lange zwischen den immer gleichen Grabsteinen alter Menschen nach Kindergräbern. Sie stellen einen Bruchteil der Gräber da. Der oft sehr aufwändige Grabschmuck, der auch häufig kindliche Motive verarbeitet, kündet unmissverständlich von der großen Liebe der verwaisten Eltern und von der Bedeutung der Kinder als Individuen, deren Tod nur allzu tragisch und unerwartet empfunden wird. Hier hingegen sind die Kindergräber nicht nur vergleichsweise häufig, sie sind auch auffallend einfach gehalten. Dies begründet sich aus der damals noch hohen Kindersterblichkeit.
Dazu passen die schlichten Grabsteine: Der Tod der Kinder war zu erwarten, es war wohl nicht ratsam, sich emotional zu sehr an sie zu binden. In Gesellschaften mit hoher Kindersterblichkeit gelten gesund geborene noch nicht als Menschen, die es ganz ins Leben geschafft haben. In den Akten des Standesamtes sind die Geburten und Tode verzeichnet – Willy, eigentlich Theodor Wilhelm Richard, war am 24.9.1894 geboren worden. Die drei Vornamen, einschließlich dessen seines Vaters und Großvaters zeigen, das es der älteste Sohn war (aber auch das jüngste Kind), der gewissermaßen als Nachfolger seines Vaters und Ausdruck des ehelichen Bündnisses gedacht war. Allerdings wurde er nur 14 Tage alt und da er als Baby starb, scheint sein Grabmal eher für seine Familie, als für die Öffentlichkeit relevant zu sein – daher heißt er hier nur „Willy“ – es war der gängige Spitzname der Wilhelms aus der Familie. Neben Linas kleinem Grabmal findet sich das Grabmal einer erwachsenen, aber jungen Frau. Die Inschrift kündet von einer familiären Tragödie: Auf einer glatten Platte aus schwarzem Granit heißt es: „Unserer unvergesslichen Tochter Frau Amtsrichter Wissmann geb. Marie Hüttenhein geb. 31. März 1860 gest. 9. Juni 1889“. Die Granitplatte ist in eine auswendig gearbeitete Umrandung aus (ehemals natürlich hellem) Kalk eingefasst und diese Umrandung stellt eine Mauer da. Marie Hüttenhein war die Tochter von Henriette und Wilhelm Sr., Schwester von Wilhelm Jr. gewesen. Sie heiratete den Bruder von Lina, der in Grevenbrück Amtsrichter wurde. Marie und Julius hatten schon 1880 geheiratet, also mögen sich Lina und Wilhelm durch diese Verbindung kennen gelernt haben. Das Paar bekam drei Töchter – Adelheid (*1883), Ida (*1884) und Margarete (* 1888). Marie starb mit nur 29 Jahren. Viel lässt sich wieder aus diesem Grabmal herauslesen, welches das älteste hier erhaltene ist: Da ist zum einen, dass eine Frau nach ihrem Mann benannt wird, der Mann nach seinem Beruf. Dies drückt aus, der Name wäre allenfalls in der Geburtsfamilie, in der Kindheit wichtig. Danach findet ein Mann seine Berufung in seiner Arbeit, eine Frau in ihrem Mann. So kommt es, dass der Grabstein uns beinahe ihren Namen verschwiegen hätte. Was auch gewiss daraus ersichtlich ist, ist die Bedeutung eines Grabsteins als Statussymbol und Kommunikationsmittel der Familie – man war wohl stolz auf die durch die Tochter geschlossene gute Ehe, auf die Verbindung der Familie Hüttenhein zum Amtsrichter. Es waren Maries Eltern, die den Grabstein bestellt hatten, und offensichtlich war es bitter und nicht mehr so erwartet – wie bei den kleinen Kindern – seine bereits erwachsene Tochter beerdigen zu müssen. Davon kündet das „unser“ und das „unvergesslich“ auf dem Grabstein. Was aber soll die Mauer? Hat sie eine Bedeutung? Schließlich mag man auf einem heutigen Friedhof vergeblich nach einem so gestalteten Grabstein suchen. Der Vergleich mit jüdischen Friedhöfen (die sich hier wieder als Reservoir zeitgenössischer Grabsteine erweisen) zeigt schnell, dass die von einer „Mauer“ umgebene Platte ein anderes typisches Design damaliger Grabsteine war. Ich selbst meine, die als aufgehäufte Steine, oder als grobes Mauerwerk gemeißelten Ränder und Sockel erinnern an uralte Grabstätten. Etwa zu Grabstätten umfunktionierte Grotten oder Höhlen, Felsengräber, an Gräber, die aus auf den Leichnam gehäuften Steinen bestanden. Im jüdischen Sinne erinnerte dieses Design einfach an die Gräber der Ahnen, im christlichen Sinne mochte es an Lazarus’ Grab oder an das Grab Jesu erinnern. Im Sinne des Historismus würde es auch dem Grab ein altertümliches Flair geben. Was aber war die Tragödie? Am 11. Juni 1889 registrierte der Standesbeamte von Förde die Aussage der Hebamme Maria Müller: „Von der Maria Wissmann, geborene Hüttenhein, evangelischer Religion, Ehefrau des Amtsrichters Julius Wissmann, evangelischer Religion, beide zu Grevenbrück, zu Grevenbrück in der Wohnung ihres Ehemannes, am neunten Juni des Jahres tausendachthundertachzig und neun, Nachmittags um viereinhalb Uhr ein Kind männlichem Geschlechts geboren und dieses Kind in der Geburt verstorben sei, und zwar in Gegenwart der Anzeigenden […]“. Beide, Mutter und Sohn, fielen also dem verbreiten Tod im Kindbett zum Opfer. Etwas ungewohnt schauen aus dem Friedhof zwei viel jüngere und schlichtere Gräber hervor – die von Hildegard Hüttenhein und ihrem Mann Nikolaus Eiden. Am 5. Februar 1889, ein Jahr nach Lina, bekamen die jüngeren Hüttenheins eine Tochter, deren Name sich laut Geburtenregister nicht sofort gefunden hatte. Später erhielt sie den Namen Hildegard-Charlotte-Wilhelmine. Sie war diejenige von den Kindern des jüngeren Hüttenhein Paares, die überlebte – am 27.11.1911 heiratete Hildegard Hüttenhein den Diplomingenieur Nikolaus Eiden. Er selbst war Katholik – auch in dieser Hinsicht sind andere Zeiten angebrochen. Trauzeugen waren Marie Schlachtenbeck (Rommel) und der Fabrikdirektor Franz König. Herr Eiden, der den Familienbetrieb nach neuesten Erkenntnissen umgestaltete, war ein geeigneter Kandidat, um diesen zu übernehmen. Das Elektrizitätswerk wurde 1931 an das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk verkauft, die Familie betrieb allerdings noch immer eine Radfabrik. Hildegard, der es gelungen war, von der gestiegenen Lebenserwartung im 20. Jh. zu profitieren, wohnte später in Trockenbrück, in dem von ihren Großeltern erbauten Wohnhaus. Ihren Mann, der vor ihr gestorben war, ließ sie auf dem Familienfriedhof bestatten – der nunmehr Teil des Evangelischen Friedhofs war. Das Grabmal, eine einfache Betonplatte, hält der Nachwelt seinen Bildungsgrad vor Augen: Die metallene Aufschrift nennt ihn als Dipl.-Ing. Nikolaus Eiden. Am 7.5.1977 verstarb sie selbst am Morgen im Sankt- Josefs-Hospital. Ihre letzte Ruhe fand Hildegard neben ihrem Mann in einem stilistisch identischen Grab – auch sie bestand sehr auf der Bedeutung ihrer Ehe. Möglicherweise reflektiert die bescheidene Beerdigung des Paares wieder eine Verschlechterung der finanziellen Umstände der Familie. Mit derselben ging es aber weiter: Hildegards Tochter Edith heiratete wieder einen Diplom-Ingenieur, W. Gericke, mit dem gemeinsam sie die Familie weiterführen sollte. Der grevenbrücker Zweig der Hüttenhein hat Nachkommen bis auf den heutigen Tag.
(2025)
Material:
Dahm-Arens, Hildegard. „Die Böden des Massenkalkes von Attendorn.“
Decheniana 139 (1986): 384-394.
https://grevenbrueck.de/wp-content/uploads/2018/04/denkmal_grev6.pdf (Dienstag, 25. März 2025)
https://grevenbrueck.de/blog/2016/12/11/evangelischer-friedhof-auf-der- hardt/ (Dienstag, 25. März 2025)
https://grevenbrueck.de/blog/2016/12/12/alter-ev-friedhof-ist-von-gestein- und-hanglage-gepraegt/ (Dienstag, 25. März 2025)
Josef Boerger, Tausend Jahre Förde-Grevenbrück, 1946, Ruegenberg, Olpe, Digitalisat: Herbert Kuba, Bochum 2006.
Archiv Lennestadt (Geburts- und Sterbebücher, Heiratregister Förde)
Die Familie Huettenhen Hüttenhain Hüttenhein, 2. Aufl., Vorländer, Siegen 1940, (1. Aufl. 1910).
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/1900_1.htm (Donnerstag, 13. März 2025)
Rudolf Gericke, Familien- und Wirtschaftsgeschichte am Beispiel der Familie Hüttenhein in Grevenbrück, in: Jahresheft des Heimat- und Verkehrsvereins e.V. Grevenbrück, Nr. 12, Lennestadt-Grevenbrück 1993, Heimat- und Verkehrsverein e.V. Grevenbrück (Hrsg.).
Lepsius, Richard. „Ägyptologen auf Berliner Friedhöfen.“
https://www.natursteinonline.de/portal/news/grabstein-motive- haendeschuetteln-als-symbol-ewiger-liebe (Mittwoch, 26. März 2025)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/ Brothers_Grimm_Grave_ASMK_Berlin_2016.jpg (Dienstag, 25. März 2025)
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/1900_8.htm (Samstag, 15. März 2025)
https://www.juedische-friedhoefe.info/friedhoefe-nach-regionen/nordrhein- westfalen/sauerland/schmallenberg/der-friedhof-von-schmallenberg.html#/ 7 (Mittwoch, 26. März 2025)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/ Schmallenberg_Jüdischer_Friedhof_8677.JPG (Mittwoch, 26. März 2025)
https://www.juedische-friedhoefe.info/friedhoefe-nach-regionen/nordrhein- westfalen/sauerland/winterberg/der-friedhof-von-winterberg.html#/1 (Mittwoch, 26. März 2025)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/ Wuppertal_Odoakerstr_0047.jpg (Freitag, 28. März 2025)