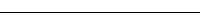von Christian Neustädter
Die Entwicklung der Stadt Wiehl ist untrennbar mit dem Erfolg eines der bedeutendsten Unternehmen der Region verbunden: der BPW Bergische Achsen KG. Seit ihrer Gründung im Jahr 1898 hat sich die BPW von einem regional begrenzten Handwerksbetrieb zu einem weltweit agierenden Technologieunternehmen entwickelt, das führend auf dem Gebiet von Fahrwerkssystemen und Mobilitätslösungen für Nutzfahrzeuge ist.
Dabei spielte das Unternehmen nicht nur eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Stabilität und den Arbeitsmarkt in Wiehl, sondern prägte auch das infrastrukturelle Gesicht der Stadt maßgeblich mit. Dieser Artikel befasst sich mit der Geschichte, Bedeutung und dem Einfluss der BPW auf die Stadtentwicklung Wiehls – ein eindrucksvolles Beispiel für das Zusammenspiel von mittelständischer Industrie und kommunalem Wachstum im Bergischen Land.
Die Bergische Patentachsenfabrik wurde am 1. Oktober 1898 durch die vier Kaufleute Otto Nohl, Friedrich Zapp und die Gebrüder Carl Ferdinand und Ernst Gustav Reusch gegründet. Die Gebrüder Reusch zogen sich jedoch bald aus der Firma zurück und verkauften 1913 ihre Anteile an ihre beiden Geschäftspartner Zapp und Nohl. Die Belegschaft dieser frühen Fabrik umfasste 20-30 Angestellte. Die Fabrik stellte zu Beginn Achsen für zweispurige Fahrzeuge her, unter anderem für Speditionsfuhrwerke, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Lastwagen und andere Nutzfahrzeuge, sowie Kutschen und Geschäftswagen.
Zu dieser Zeit war Wiehl eine kleine Dorfgemeinde von knapp 3000 Einwohnern und war größtenteils von der Landwirtschaft geprägt. Ein Faktor, der sowohl die Entwicklung der Firma als auch die der Stadt begünstigte, war der Anschluss Wiehls an das Eisenbahnnetz. Wiehl war zuvor eine verkehrstechnisch wenig erschlossene Region. Die Gründung der Wiehltalbahn 1897 war ein Meilenstein der Infrastruktur, da sie den Transport von Waren und Personen erheblich vereinfachte. Für die BPW stellte sie eine grundlegende Voraussetzung für ihre Expansion dar.
Der Eintritt des auslandserfahrenen Kaufmanns Gustav Friedrich Kotz in das Unternehmen im Jahr 1901 stellte einen wichtigen Wendepunkt dar und sollte dem Unternehmen auch im Ausland Bekanntheit verschaffen. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wird Gustav Friedrich Kotz alleiniger Inhaber der Bergischen Achsengesellschaft. Hinzu kamen technische Innovationen, die einen enormen Umsatz für den Betrieb erwirkten. Eine der frühsten Neuerungen war die sogenannte ,,Patentachse“, die eine verbesserte Weiterentwicklung der Schmierachse darstellte, in der Verarbeitung jedoch technisch anspruchsvoller war. Die ,,Wiehler Patentachse“ stellte die erste Eigenentwicklung dar, die die BPW auf den Markt brachte. Zusätzlich zu den weiterhin produzierten Schmierachsen und den teureren Patentachsen wurde die Produktion auf die Herstellung von einzelnen Bauteilen für Achsen, vor allem Achsenrohlingen, ausgeweitet. Die erweiterte und anspruchsvollere Produktion erforderte immer mehr Arbeitskräfte. 1918 erreichte die Belegschaft der BPW mit 245 Beschäftigten ein neues Hoch.
Während des 1. Weltkrieg profitierte die BPW von dem gestiegenen Bedarf an Achsen für Militärfahrzeuge. Die Fabrik konnte erheblich ausgebaut und modifiziert werden. 1920 unternimmt die BPW die ersten Versuche, Achsen für Automobil- und LKW-Hersteller zu fertigen.
Die Entwicklung der patentierten Rollenlagerachse im Jahr 1924 verhalf der BPW zum internationalen Durchbruch und machte sie zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Dieser neue Achsentyp hatte auf den Markt keine Konkurrenz und konnte so in vielen Ländern Absatz machen. Die größten europäischen Importeure der neuen Rollenlagerachsen waren die Niederlande und England. Außerhalb von Europa wurden die Achsen unter anderem in Australien, Südamerika, Thailand, Südafrika, Ägypten, Japan, Indonesien und Neuseeland verkauft. Von den 1930er Jahren bis in den 2. Weltkrieg erlebte die BPW eine weitere Blütezeit. Das ständige Wachstum des Unternehmens zog Arbeitskräfte an, sowohl unqualifizierte als auch qualifizierte Facharbeiter, die sich mit ihren Familien in der Stadt niederließen. Die Arbeiterzahl stieg rasant an. 1937 beschäftigte die BPW 780 Mitarbeiter, 1939 verdoppelte sich die Zahl beinahe auf 1327 Mitarbeiter.
Der 2. Weltkrieg war zwar eine produktive Zeit für die BPW, enthielt jedoch auch einige der düstersten Momente in ihrer Geschichte. Die kriegswichtige Position der Firma sicherte ihr Unterstützung der Autoritäten und eine gesicherte Rohstoffzufuhr. Jedoch setzte sich die Belegschaft nicht nur aus Arbeitern aus Deutschland zusammen. Zusätzlich mussten rund 352 Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjetunion im Werk arbeiten.
Diese Zuwanderung an neuen Arbeitskräften für die BPW spiegelte sich in der Entwicklung der gesamten Einwohnerzahl Wiehls wieder. Von ungefähr 4300 Einwohnern um 1900 stieg die Bevölkerung bis 1950 auf 18000. An den Mitarbeiterzahlen der BPW zeigt sich, welche wichtige Rolle die Firma bei dem Wachstum der Stadt spielte. 1960 umfasste die Belegschaft der BPW 2000 Mitarbeiter. Diese Zuwachsraten liegen deutlich über dem Durchschnitt, der in ländlichen Regionen üblich war. Nach dem 2. Weltkrieg spielte die BPW eine entscheidende Rolle als Arbeitgeber für Migranten und Vertriebene, die durch den Krieg ihre Existenzgrundlage verloren hatten. 1964/65 wurden aufgrund des hohen Bedarfs an Arbeitskräften erstmals Gastarbeiter eingestellt, unter anderem aus Italien, Jugoslawien und später der Türkei.
Nach dem 2. Weltkrieg kamen weitere Neuerungen aus der BPW hervor, die die Automobilindustrie weiter revolutionieren sollte. Diejenige, die am meisten Aufsehen erregte erschien 1971. In diesem Jahr wurde die neue Luftfederachse entwickelt. Um ihre Vorteile zu demonstrieren, wurde eine Testfahrt nach Nordschweden bis zum Polarkreis unternommen. Diese erstreckte sich über einen Zeitraum von 200 Stunden, in denen ein Trailer ohne Unterbrechung 13000 km zurücklegte. Von diesem Erfolg beflügelt eröffnete die BPW eine neue Produktionsline für Trailerachsen.
Auch in den 1990er und frühen 2000er Jahren wurden neue Innovationen aus der BPW veröffentlicht. 1999 erschien das neue ECO-System, das eine wartungsfreundlichere und wirtschaftlichere Weiterentwicklung der Lagertechnik einführte. Die neuen Innovationen hatten einen positiven Effekt auf die Belegschaft der BPW: 2004 wurden 200 neue Arbeitskräfte eingestellt.
Die Ölkrise der 1970er Jahre stellte die erste große Krise der BPW dar. Die stark angestiegenen Energiepreise führten auch in Wiehl zu Produktionseinbußen und Entlassungen. In den frühen 2000ern erlebte die Firma mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und 2009 eine weitere schwierige Phase. Doch obwohl viele Angestellte in Kurzarbeit arbeiteten, konnten 2009 zwei weitere Neuerungen auf den Markt gebracht werden: das Elektronische Bremssteuerungssystem ECOTronic EBS und die Trailerachsenbremse ECO Disc.
In den 80er Jahren erfuhr die BPW eine erhebliche Technisierung. 1981 wurde im Werk der BPW der erste Schweißroboter installiert. 1982 kam ein durch Computertechnik betriebenes Hochregallager für Montageteile hinzu. 1985 arbeiteten bereits vierzig rechnergesteuerte Werkzeugmaschinen im Werk. Auf die Größe der Belegschaft der BPW hatte diese neue Technisierung allerdings nur minimalen Einfluss. 1990 arbeiteten allein im Wiehler Stammwerk 1800 Mitarbeiter. 2023 arbeiteten 1600 Menschen dort.
Die ständig wachsende Belegschaft der BPW führte zu der Notwendigkeit, neue Möglichkeiten zur Unterbringung für das Personal zu schaffen. Daher begann in den 1920er Jahren ein Bauvorhaben, das das Bild der Stadt verändern sollte. Im Jahr 1920 wurden zwei Werkwohnhäuser und drei Beamtenwohnhäuser in Fabriknähe errichtet. Aufgrund der hohen Beschäftigungszahl errichtete Gustav Friedrich Kotz 1938 weitere Siedlungshäuser in der näheren Umgebung der Firma. Der Bau der Arbeiterwohnungen wurde nach dem 2. Weltkrieg unter Gustav Kotz Sohn Fritz Kotz weiter fortgeführt. In Heckelsiefen bei Oberwiehl begannen wenige Monate nach der Wiederinbetriebnahme des Werkes im Jahr 1945 die Bauarbeiten für eine neue Arbeitersiedlung. Diese Wohngebiete für die Belegschaft der BPW prägen das Bild von Stadtteilen wie Oberwiehl bis heute.
Zusätzlich zu dem neuen Wohnraum wurden auch neue Maßnahmen in der verkehrlichen und technischen Infrastruktur notwendig, sowohl für die An- und Auslieferung der Waren und Güter, als auch für das Pendeln der Arbeitnehmer. Zu diesem Zweck wurden Verkehrsknotenpunkte geschaffen, die heutzutage immer noch Hauptverkehrsachsen des Oberbergischen Kreises sind. Zu diesen Knotenpunkten gehören unter anderem die in den 1970er Jahren vorgenommene Anbindung des Ortes an die Bundesautobahn A4, sowie die 1971 erbaute Wiehltalbrücke. Auch innerstädtisch wurde die Verkehrsinfrastruktur kontinuierlich angepasst. Beispiele hierfür wären die Ortsumgehung L321, sowie der barrierefreie Ausbau des ÖPNV-Netzes mit modernen Bushaltestellen. Diese Maßnahmen dienten speziell der Verbesserung der Erreichbarkeit des industriellen Zentrums Wiehls, allen voran der BPW. Gleichzeitig stellten sie eine große Erleichterung für den allgemeinen Verkehrsfluss dar.
Wie aus dem letzten Abschnitt hervorgeht, wirkt sich der Einfluss der BPW nicht nur direkt, sondern auch indirekt auf die Stadtentwicklung aus. Eine wachsende Stadt erweckt in absehbarer Zeit das Interesse anderer Händler und Unternehmer, die sich davon neue Kundschaft versprechen. Die Expansion von BPW führte zur Ansiedlung zahlreicher Zulieferbetriebe und Gewerbe, die die Stadt als Wirtschaftsstandort attraktiver machten. Die Anwesenheit von vielen Betrieben hatte auch einen positiven Mehrwert auf den Wohlstand der Stadt selbst. Die kontinuierliche Entwicklung der Firma sorgte dafür, dass Wiehl einen stabilen Haushalt besaß und sich zu einer prosperierenden Gemeinde entwickelte.
Auch aus sozialer Perspektive setzte die BPW neue Maßstäbe. 1919 führte der damalige Firmenbesitzer Gustav Friedrich Kotz die erste Betriebskrankenkasse der Region ein. Der Vorteil wirkte sich auf die ganze Bevölkerung aus, da die Familien der Mitarbeiter mitversichert waren. 1938 wurde das Sozialgebäude um eine Großküche erweitert. Hinzu kam eine Erweiterung der Bürogebäude. 1955 kam ein neues Sozialgebäude mit klinischen Einrichtungen und eigenem Werksarzt hinzu. Zusätzlich zu den medizinischen Einrichtungen wurde eine Werksbücherei eröffnet.
Neben dem wirtschaftlichen und sozialen Aspekt engagiert sich die BPW ebenfalls stark im schulischen und beruflichen Ausbildungssystem der Stadt. Dieser Aspekt tritt besonders seit dem 21. Jahrhundert deutlich zu Tage. So arbeitet die BPW seit 2006 eng mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wiehl zusammen, unterstützt Projektkurse und Forschungs- Wettbewerbe wie MINT und bietet Workshops für Schüler in Bereichen wie Unternehmensführung, BWL und weiteren Bereichen an. Darüber hinaus bietet BPW zahlreiche Praktikums und Ausbildungsplätze an. Somit hat BPW auch einen großen Einfluss auf den Bildungsgrad der Stadt Wiehl. Darüber hinaus kooperiert die BPW mit Universitäten und Hochschulen wie der TH Köln/Gummersbach und unterstützt junge Menschen mit Förderprogrammen.
Die BPW ist sich ihrer eigenen reichen Historie bewusst. Zu diesem Zweck eröffnete Fritz Kotz 1952 das BPW Museum Achse, Rad und Wagen, das Einblicke in die Geschichte der Firma, die Entwicklung der Achsen und Patenturkunde der Produkte gibt. Besucher können sich auf diese Weise auf eine Zeitreise in die Vergangenheit der Firma, des Ortes und des Lastentransports an sich begeben.
Seit ihrem Eintritt ins Unternehmen ist die Firma fest in der Hand der Familie Kotz. Nach dem Tod von Gustav Friedrich Kotz übernahm Christian Peter Kotz die Geschäftsführung. Im Jahr 2011 trat er nach 50-jähriger Tätigkeit als Unternehmensführer zurück. Seitdem leitete Uwe Kotz, zusammen mit Michael Pfeiffer, Irmgard Scherer und Markus Schell das Unternehmen. Seit 2021 ist mit Jan Achim Kotz die vierte Generation der Familie Kotz als Geschäftsführer der BPW tätig.
Wiehl und die Bergische Achsenfabrik zeigen deutlich, wie sich Industrie und Kommunen ergänzen, um einen starken Standort entstehen zu lassen. Die Geschichte von Wiehl und der BPW ist ein gutes Beispiel für eine wechselseitige Entwicklung. Die Stadt bot dem Unternehmen den Raum und die Infrastruktur, die sie für ihr Wachstum benötigte. Gleichzeitig stellte die BPW durch Arbeitsplätze, Innovationen und gesellschaftliches Engagement die Grundlage für die städtische Entwicklung dar. Fast jeder Einwohner der Stadt Wiehl hatte oder hat einen Verwandten/ Familienmitglied, das in der BPW beschäftigt war oder ist. Als umsatzstarke Firma bietet das Unternehmen weiter einen sicheren Ausbildungsplatz für die junge Generation in der Heimat.
Der Erfolg von BPW geht weit über die Grenzen der Stadt Wiehl hinaus. Die innovativen Achsen und Bremsanlagen sind auf der ganzen Welt Teil der Automobil-Industrie und haben Wiehl dadurch größere Bekanntheit verschafft. Es ist also zutreffend zu behaupten, dass Stadt und Betrieb sich gegenseitig gefördert haben. Das Motto von Gustav Friedrich Kotz aus dem Jahr 1947, betraf früher und heute Stadt und Unternehmen zugleich: ,,Seid einig, einig, einig! Denn Einigkeit macht stark.“
(2025)
Literaturliste
125 Jahre BPW Bergische Achsen. Wiehl 2023.
Bpworld. Das Mitarbeitermagazin der BPW Gruppe. Antrieb, Ausgabe 01 2021. Bpworld. Das Mitarbeitermagazin der BPW Gruppe. Verantwortung, Ausgabe 01 2022. IT.NRW-Kommunalprofil. Detaillierte Entwicklung.
Stadt Wiehl Webseite. Amtliche Zahlen.
Wilhelm Treue: Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1986.