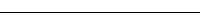von Marie Trybula
Wir alle kennen den Ausdruck: „In Stein gemeißelt“. Er bezeichnet etwas, das ewig, unverrückbar, festgesetzt und überzeitlich ist, oder zumindest sein soll. Mir begegnete er etwa in einem Seminar, als ein Dozent uns im Bezug auf das Ende einer Frist beruhigte, indem er sagte, dieses Datum sei „[…] nicht in Stein gemeißelt.“ Wieweit aber entspricht so eine Ansicht, so ein Ausdruck der Realität? Nun etwas ist schon dran: In Stein gemeißelt ist etwa die „Laudatio Turiae“, die Grabinschrift einer römischen Frau.
Römische Grabinschriften halten die Leistungen eines Menschen fest. So ist dort beschrieben, wie sie kurz vor ihrer Ehe ihre Eltern verloren hat, die getötet wurden – es war die brutale Zeit der Proskriptionen – wie sie hart gearbeitet und einen Haushalt geführt hat – ihre Wollarbeit wird erwähnt. Ihr Mann, der die Grabrede verfasst hat, beschreibt sie als keusch, züchtig und nüchtern gekleidet, religiös, ohne abergläubisch zu sein, „gehorsam [sic]“, treu, vernünftig und fleißig, so weit, so normal für Rom zu Caesars und Augustus Zeiten. Aber da ist noch etwas: Ihr Mann beschreibt ausführlich, wie seine Frau ihn zur Zeit der Proskriptionen, als er sich vor Leuten verstecken musste, die im Nahmen mächtiger Politiker ihn ermorden und sein Vermögen sich aneignen würden, im Versteck versorgte. Dann setzte sie sich vor Augustus für die Streichung ihres Mannes von der Proskriptionsliste ein. Die blauen Flecken, die Schrammen, die sie sich zuzog, als sie von den Wachen des Herrschers aus seiner Gegenwart weggezerrt wurde, werden ausdrücklich erwähnt. Eine heldenhafte Ehefrau, ihre Taten in Stein gemeißelt. Darum wissen wir heute auch von Turia, ihrem Mann, den sie beschützt hat, ihren Taten. Weil sie „in Stein gemeißelt wurden“ und sich somit später mal in der Fülle der sogenannten epigrafischen Quellen – der erhaltenen Inschriften – finden würden. Auch heute sind wir umgeben von Dingen, die „in Stein gemeißelt“sind, das mögen Inschriften von Denkmälern sein, häufiger sind es Grabsteine. „Die Umsätze im Bestattungswesen in Deutschland sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Während die Beerdigungsbranche im Jahr 2011 Umsätze in Höhe von rund 1,56 Milliarden Euro verzeichnen konnte, betrugen die Umsätze im Jahr 2022 knapp 2,76 Milliarden Euro.“, so de.statistika.com. Es gibt heute einen Trend zur Individualisierung der Bestattung und zu alternativen Formen – eine Seebestattung mag nicht allein durch Notwendigkeit bedingt sein, es gibt Diamantbestattungen und Friedwälder, längst ist auch in den USA mit der Kompostierung von Verstorbenen experimentiert worden, oder auch mit dem Auflösen in Lauge. Die meisten Menschen entscheiden sich jedoch für die beiden klassischen Bestattungsarten, Erd- und Feuerbestattung auf einem kommunalen Friedhof oder dem Dorffriedhof bei der Kirche. Unser etwa, der katholische Friedhof von Grevenbrück, erstreckt sich zwischen der Kirche und dem Fuß des Buchhagens. So erstreckt sich dieser besondere „Garten“ einen Hang herauf, geprägt von Rasen, Alleen aus in Form geschnittenen Bäumen und der Hecke hinten, die aus verschlungenen Büschen und Apfelbäumen besteht. Um Wege herum angeordnet sind die zu einem klassischen Begräbnis gehörenden Grabsteine. Am anderen Ende des Dorfes, auf dem „Hohen Hagen“, hoch über dem Bahnhof mit Aussicht auf das Elspetal ist der evangelische Friedhof in den steilen Hang eingelassen, umgeben von einem jungen Wald. Er ist viel kleiner, auch hier gibt es Rasen und Wege, auch hier erheben sich hohe Bäume, diesmal Zypressen und andere Nadelbäume. Auch hier kann man nach oben gehen, bis an die letzte Gräberreihe. Friedhöfe in unserem Kulturkreis, wie auch die beiden in Grevenbrück, eint, dass oberirdisch, über der Stelle, an der der Leichnam oder die Asche eines Menschen in der Erde vergraben worden sind, ein Gedenkstein das Grab markiert – ein Grabstein. Name, Lebensdaten und vielleicht ein Symbol, wie etwa ein Kreuz, eine Taube, ein Baum oder ein Spruch sind eingraviert oder aus Metall geschmiedet angebracht. Oft sind sie aus Granit, manchmal auch aus anderem Stein. Sie können eckig, rund, in Form eines Kreuzes oder eines Buches sein. Sie können glatt poliert oder naturbelassen sein, manchmal ist eine Seite so, die andere so. Da ist also viel Raum für Gestaltung für die Hinterbliebenen. Die Gemeinsamkeit ist aber die, dass der Name des oder der Verstorbenen mit dem Zeitfenster, in dem er oder sie gelebt hat, „in Stein gemeißelt“, verewigt wird. Auch wenn man bei neuzeitlichen und zeitgenössischen Grabsteinen darauf schauen mag und sich fragen mag, wer das denn nun gewesen ist. Auch wenn man in ein Archiv, oder lebende Angehörige aufsuchen müsste, um den Lebensweg eines solchen Menschen nachzuzeichnen. Auch wenn Marmor, Stein und Eisen bricht, ist es doch so, dass ein Granitblock mit einer eingemeißelten Inschrift grundsätzlich so beschaffen ist, dass er auch noch Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, nachdem die Knochen dieses Menschen sich in der Erde schon längst aufgelöst haben, uns verkündet: „Schau! Dieser Mensch hier, der mit diesem Namen gerufen wurde, hat dann und dann gelebt.“ Und dann betrachtet man ihn aufmerksam und denkt sich: – wer war das, was hat er gemacht, mit seinem Leben? Warum hieß er Rudolf, warum hieß sie Erna? Allenfalls mag ein besonders bescheidenes, nicht gepflegtes Grab mit einem einfachen Holzkreuz auf ein armes, vielleicht einsames Leben am Rande der Gesellschaft, oder zumindest nicht in ihrem Zentrum hinweisen. Aber gravierter Granit signalisiert Unvergänglichkeit, ewiges Gedenken … und dann kommt das Ende der „Ruhezeit“. Auch das zeichnet Friedhöfe aus – die ausrangierten Grabsteine von Menschen, deren Gräber „neu vergeben“ werden sollen. Es gibt auch „aufgelassene“ Friedhöfe und wer weiß, was noch an deren Stelle kommt. Aber auch in aktiven Friedhöfen findet man in abgelegenen Ecken, in Kompostgruben oder am Zaun/der Mauer des Friedhofes alte, ausrangierte Grabsteine je nach Größe und dem zeitlichen Abstand zur letzten Abholung ein paar, oder auch so viele, dass sie sich stapeln. Und so stehe ich in diesem Frühling in unserem evangelischen Friedhof und frage mich, ob das Ende der „würdigen“ und angeblich ewigen dreißig oder zwanzig Jahre die hohen Kosten von Beerdigungen rechtfertigt. Mein Blick fällt nach Norden, auf die „Hardt“, auf jenen steilen, felsigen Hang, über dem sich früher der „Liebespfad“ gewunden hat, an dessen Fuße mal das Haus Molitor gewesen ist und westlich von dem der Steinbruch sich noch immer in den alten Fels hineinfrisst, der mal ein Riff gewesen. Jetzt ist früher März, deshalb verdeckt das Blätterdach des umliegenden Waldes nicht die Sicht: Dem evangelischen Friedhof gegenüber, beinahe glänzend im Lichte der Sonne, jedenfalls klar erkennbar, liegt der Alte Evangelische Friedhof an der Hardt auf seinem künstlich angelegten Plateau. In den letzten Jahren hat man diesen Friedhof – ein Denkmal – zunehmend gepflegt und renoviert. Zuletzt wurde er mit einem Metallzaun umgeben und, wenn man so will, eingesperrt – wohl, wie man so sagt, zu seiner eigenen Sicherheit. Um diese Zeit erwacht auch der Wald um diesen Friedhof. Hinter der Friedhofsmauer, die den Friedhof vor allem gegen das Abrutschen ins Tal absichert, brechen etliche Büschel von Schneeglöckchen in ihrer Mischung aus leuchtenden Weiß und frischem Grün aus dem sepiafarbenen Laub des letzten Jahres hervor. Auf dem Friedhof selbst beleben unzählige kräftig violette Krokusse den kupferfarbenen Teppich aus Buchenlaub. Sie versehen die sonst ruhige und sogar etwas raue Umgebung des Friedhofs, geprägt von Felsen, Dornbüschen, der großen, ausladenden Buche und dem übrigen, von Eschen dominierten Wald, mit glänzenden Flecken kräftiger, frischer Farbe. Und zwischen diesen Farbtupfern finden sich wieder Grabsteine. Beschrieben habe ich diese Grabsteine schon an anderer Stelle. Auch sie sind individualisiert, haben verschiedene Formen und Symbole, auch sie sind in verschiedenen Qualitäten gehalten: Granit für die Hüttenhein Familie (außer Hildegard und ihrem Mann, die unter Betonplatten ruhen), aus Ziegeln gemauerte und verputzte Grabmäler für die übrigen hier bestatteten Menschen. Eines der Gräber spricht mich besonders an, das einer jungen Frau. Die Erde in der typischen Grabumfassung hat sich abgesenkt. Nun wachsen hier wilde und verwilderte Pflanzen. Im Frühling springt auch hier eine Kolonie der kräftig violetten Krokusse hervor. Über dem Grab erhebt sich ein interessanter Grabstein. Eine feine Platte aus schwarzem Granit, umrahmt von einer wohl aus Kalkstein gemachten „Mauer“ beinhaltet eine interessante Inschrift, die schon ein bisschen mehr verrät, als die meisten. Die Platte ist so fein, dass sie – ähnlich, wie das Kreuz, das auf dem Grab der Schwester der Verstorbenen gestanden hat – schon zersprungen ist. Ich weiß nicht, ob wegen Gewalt, oder Witterung. Jedenfalls meinte jemand, noch ehe ich den Friedhof entdeckt habe, dass es witzig wäre auf zumindest einigen der Grabmale rote Farbe zu verschmieren. So oft ich auch auf dem Friedhof gewesen bin, war das Grab das erste, das mir in Auge gefallen ist und möglicherweise war es das erste Grab des Friedhofs überhaupt. In Granit gemeißelt ist zu lesen:
Unserer unvergesslichen Tochter
FRAU AMTSRICHTER
WISSMANN
GEB. MARIE HÜTTENHEIN
geb. 31. März 1860
gest. 9. Juni 1889
An die Nachwelt wenden sich in dieser Grabinschrift Maries Eltern – Henriette Zimmermann (1820-1899) aus Buschhütten und Wilhelm Hüttenhein (1816-1895) aus Hilchenbach. Ich war fasziniert – nicht nur finde ich endlich einmal alte, historische Gräber aus einer anderen Zeit. Aber die Inschrift drückt auch die große Trauer der Eltern über den Tod der Tochter aus, die große Liebe zu ihr. Schmerz und Sehnsucht überdauern im Stein. Sind das zu pompöse Gefühle für ein – so mögen manche kritisieren – „kleines Dorf“? Waren Maries Eltern nicht viel zu „bodenständig“, das heißt materialistisch und gefühlskalt für so etwas „Dekadentes“, das sich nur vermeintlich der Realität entrückte Großstädter „leisten“ können? Aber vielleicht sollte man Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Judith Butler und Karl Marx öfter mal bei der Interpretation historischer Quellen beiseite lassen und einfach mal dem Wort der Zeitgenossen selbst etwas Gewicht beimessen. Die Inschrift jedenfalls spricht eine sehr klare Sprache. Und mehr lässt sich aus dem Grabstein allein schließen: Ich erwähnte schon an anderer Stelle, dass das Andenken der Dame „ummauert“ ist. Das ist ein Grabmaldesign, das im späten 19./ frühen 20. Jahrhundert einfach beliebt war, ähnlich wie der Obelisk. Auf jüdischen Friedhöfen finden sich Grabmale aus der Zeit, durchaus auch solche mit Platten aus Kalk, statt Granit, die in die „Mauer“ eingelassen sind, oder auch als Steinhaufen, oder Mauerwerk stilisierte Sockel. Das lässt den Grabstein altertümlich wirken, wie ein uraltes Felsengrab, das mit einem Stein verschlossen war, oder an eine Grotte. Das Design wirkt romantisch, sanft, strahlt Ruhe aus. Diese Form (ich schrieb schon darüber) war Standard und fand sich auch auf Gräbern von Männern. Dennoch passt das Design irgendwie seltsam gut – wir werden das noch sehen – zum bürgerlichen Frauenideal des viktorianischen, des wilhelminischen Zeitalters, wie es in ganz Europa verbreitet war. Und dann begegnet sie uns zuerst als „Frau ihr Ehemann, geborene eigener Name“. Eine interessante Formel, zu der viel zu sagen wäre. Dann sind da noch die Lebensdaten. Einst besuchte ich mit meiner Mutter den Friedhof. Auch sie blickte auf den Grabstein und sagte sofort: „Sie ist nur 29 Jahre alt geworden, das war bestimmt der Tod im Kindbett.“ Umso faszinierter war ich. Mehr sagt der Grabstein nicht aus, also zog es mich ins Archiv Lennestadt. Hier findet sich eine Genealogie der Familie, ursprünglich von 1910, das Archiv besitzt die 2. Auflage von 1940. Auf Seite 91 begegnet man hier schließlich dem grevenbrücker Zweig – begründet durch den älteren Wilhelm und Henriette. Marie war die jüngste von drei Kindern: Ihr Bruder Wilhelm (1858-1916) war wie sein Vater Industrieller in Grevenbrück. Er betrieb das Elektrizitätswerk in Trockenbrück und die Gleislose Bahn im Veischedetal. Sie hatte auch eine ältere Schwester, Emma (1854-1923). Emma heiratete 1876 Clemens Lind (1833-1895), zuletzt Landgerichtsrat in Duisburg. Die Schwester war Mutter zweierTöchter geworden: Ada (*1878), dürfte jung gestorben sein. Die jüngere, Elli (*1880), die in Bonn lebte, heiratete den Maler Emil Krupa-Krupinski (+1924) und hatte selbst zwei Töchter: Ilse und Liesel. In Bonn starb auch Emma, vielleicht weil sie so ihren Lebensabend nahe ihrer Tochter und ihren Enkelinnen verbringen konnte. Marie selbst heiratete 1880 Julius Wissmann (1850-1900), Sohn des marienberger Landrats Th[eodor] Wissmann, Amtsrichter in Förde. Das Paar hatte drei Töchter: Adelheid, die älteste, (*1883) heiratete Dr. med. Phillip Ahrens in Wiesbaden. Ida (*1884) zog es in die selbe Stadt wie ihre Schwester. Sie war zunächst verheiratet mit Rechtsanwalt Braß, dann mit dem Kunstbildhauer Wilhelm Bierbrauer. Die Jüngste, Margarete, kam 1888 auf die Welt. Sie würde nach ihrer Hochzeit mit Dr. Lahrmann in Großschlottbeck leben. Das jüngste Kind ist nicht in der Genealogie verzeichnet, da es tot geboren wurde und nicht mehr getauft werden konnte. Die tragische Geburt ist einem der Geburtsbücher von Förde verzeichnet. Der Standesbeamte strich das übliche Formular für Geburten durch und schrieb daneben eine handschriftliche Notiz: „Von der Maria Wissmann, geborene Hüttenhein, evangelischer Religion, Ehefrau des Amtsrichters Julius Wissmann, evangelischer Religion, beide zu Grevenbrück, zu Grevenbrück in der Wohnung ihres Ehemannes, am neunten Juni des Jahres tausendachthundertachzig und neun, Nachmittags um viereinhalb Uhr ein Kind männlichem Geschlechts geboren und dieses Kind in der Geburt verstorben sei, und zwar in Gegenwart der Anzeigenden […]“. Unter diesen Zeilen prangt deutlich, gut leserlich und selbstbewusst geschwungen die Unterschrift der Maria Müller, der örtlichen Hebamme. Was schiefging, lässt sich nicht mehr sagen. Die Genealogie überliefert nicht, dass Julius Wissmann wieder geheiratet hätte, jedenfalls starb er mit 50 und wurde – wie es scheint – anderenorts beerdigt. Sein Grab ist auf dem Friedhof jedenfalls nicht zu sehen. Seine älteste Tochter war damals 17, die jüngste zwölf. Bestimmt übernahmen Onkel und Tante die Verantwortung für die jungen Damen, aber das kann ich, wie so vieles nicht sicher sagen, allenfalls vermuten. Maries Bruder heiratete Julius’ Schwester Lina – seine Schwägerin, wie es in der Genealogie heißt. Sie heirateten 1882 und lernten sich über das andere Paar kennen, vielleicht als Lina wegen Maries Hochzeit zu Besuch in Grevenbrück war? Die Genealogie listet die Kinder des Paares auf: Erna (1883-1901), Lina (1885-1888), zuletzt den Sohn Willi, der 1894 auf die Welt kam und nach 16 Tagen starb. Allein die jüngste Tochter Hildegard (1889-1977) konnte mit ihrem Mann, dem Diplom-Ingenieur Nikolaus Eiden, den sie 1911 heiratete, die Familie weiterführen. Die zwei Kinder dieses Paares waren Margret, zu der nichts weiter erwähnt ist und Edith, die 1937 den Diplom-Ingenieur W. Gericke heiratete und Nachkommen hatte. Marie hatte also sichtlich Glück oder Erfolg mit ihren Kindern, denn Kindersterblichkeit war um 1900 in Deutschland viel verbreiteter als heute. „Kinder, die um 1900 geboren wurden, kamen in den meisten Fällen zu Hause zur Welt. Eine Hebamme oder Nachbarinnen halfen der werdenden Mutter. Eine Klinikgeburt war sozial anrüchig. Nur die allerärmsten Frauen aus den städtischen Unterschichten, Ledige, Frauen ohne feste Bleibe, gingen in die Gebäranstalt oder ein Spital. Der ‚Schritt ins Leben‘ war höchst unsicher, denn viele Kinder überlebten das erste Lebensjahr nicht. Die Säuglingssterblichkeit war um die Jahrhundertwende immer noch hoch. Zwar hatte sie um 1870 ihren Höhepunkt erreicht und war dann wieder gesunken, aber um 1900 starben im Deutschen Reich jährlich noch etwa vierhunderttausend Kinder. Damit überlebte jeder fünfte Säugling (bei den unehelichen sogar jeder dritte) das erste Lebensjahr nicht. Je mehr Kinder in einer Familie geboren wurden, desto mehr verstarben. […] Die Säuglingssterblichkeit ging zuerst im ‚neuen Mittelstand‘ zurück, in den Familien der Beamten, Angestellten und Freiberufler, aber auch in der Facharbeiterschaft. Hier wuchs das Bewußtsein für Hygiene und kindgemäße Bedingungen des Aufwachsens am ehesten“, so die Webseite des Deutschen Historischen Museums. Das bedeutet, dass Marie und Lina, deren Geburtshilfe routinemäßig von Maria Müller geleistet wurde, sowohl für die Zeit typische Geburten hatten, als auch die besten Voraussetzungen für Geburtenkontrolle einerseits (je „nur“ vier Kinder) und für das gesicherte Überleben ihrer Kinder andererseits. Es zeigt aber auch, dass selbst bei vergleichbaren Haushalten es bessere Maßnahmen, oder einfach mehr Glück geben mochte. Das also war sie. Wie aber hat sie gelebt? Die Kindersterblichkeit erwähnte ich ja schon. Aufgewachsen ist sie in dem mit Schiefer verkleideten Haus, das die Familie nahe der Gerberei 1855 bauen ließ. „Um dieses wurde ein Park nach englischem Vorbild angelegt“, schreibt Rudolf Gericke, Nachkomme von Edith. „Es wurden viele ausländische Bäume und Ziersträucher angepflanzt. Viele konnten in dem sauerländischen Klima nicht heimisch werden und gingen ein. Doch ein amerikanischer Tulpenbaum blüht noch heute in jedem Frühsommer. Rund um den Parkteich, der aus dem Obergraben der Gerberei gespeist wurde, standen besonders schöne Fliedersträucher. Die Laubbäume sind inzwischen zu Baumriesen geworden. Fünfzehn Kastanien, Linden und Ahornbäume mußten nach dem Zweiten Weltkrieg entfernt werden, da sie durch den Artilleriebeschuß stark beschädigt worden waren.“ Hier kam die Jüngste zur Welt – ihre Geschwister noch in der Wohnung am Brückenhaus – und hier wuchs sie auf. Das Wohnhaus, in dem auch Hildegard verstorben ist, kann man noch heute in Trockenbrück sehen. Den Teich gibt es noch immer, einige der Baumriesen wurden zuletzt leider gefällt und hinter dem nach Siegerländer Vorbild mit Schiefer besetzten Haus wächst ein wildes Dickicht. Sicher war der Garten damals jugendlicher, frischer, es wurde über Pflanzen, die man pflanzen oder ersetzen wollte, bestimmt voller Enthusiasmus nachgedacht. Die Wirtschaftsgebäude hinter dem Haus, ursprünglich nach hilchenbacher Vorbild angelegt, wie Rudolf Gericke schreibt, um die Lohmühle und Gerberei zu beherbergen, waren sicher voller Geschäftigkeit. Gegenüber war sicher auch damals eine Wiese oder ein Feld, heute blickt man vom Haus auf ein Wäldchen, das das grevenbrücker Kalkwerk abschirmt. Der Friedhof der Familie ist von hier aus rasch zu erreichen, auf dem Berg genau im Nordwesten des Hauses. „Wilhelm Hüttenhein beschäftigte sich in seiner Freizeit mit Naturwissenschaften und beteiligte sich an den Ausgrabungen auf dem Hespecker Gräberfeld und in den Höhlen bei Heggen. Bekannte Forscher, die sich für Vorgeschichte interessierten, besuchten Wilhelm Hüttenhein. Herr von Dechen, nach dem die Dechenhöhle bei Iserlohn benannt ist, verwendete die Forschungsergebnisse von Wilhelm Hüttenhein unter Namensnennung in seinen Schriften […] Auf der Hardt, seinem Lieblingsplatz, hatte er einen Familienfriedhof anlegen lassen, auf dem er beerdigt wurde“, schreibt sein Nachkomme. Es war ein sehr schöner Ort – ob die Familie hier manchmal sonntags spazieren ging? „Bevor die Kalkwerke gegründet waren und der Dolomitstein hierzulande noch „Wasserkalk“ genannt wurde, war die Hard Laubwald bis hinunter nach Borghausen. Von der „Bärenhöhle“, einer interessanten Felspartie oberhalb des Friedhofes, führte der sogenannte „Liebespfad“ bis hinunter zur Sporker Schlade. Ein romantischer Liebespfad mit Ruhebänken, und im Frühling an beiden Seiten eingefaßt mit herrlichen Maiglöckchen, immer in Windungen über Felspartien, die Blicke der Spaziergänger auf das zu Füßen liegende Lennetal, den gegenüberliegenden breiten Hagen mit seinen Burgruinen freigebend“, beschreibt Josef Boerger die so nicht mehr vorhandene Landschaft und fügt bedauernd hinzu: „Tempi passati!“ Rudolf Gericke schreibt auch von Fleiß und Sparsamkeit, die das gute, ja elegante Leben der Familie ermöglicht hätten. Wie die Wirtschaftsgebäude direkt neben dem englischen Garten mit exotischen Pflanzen und blühenden Ziersträuchern bei dem als ein Stück Heimat im Sauerland erbauten Wohnhaus standen, verband sich, wie es scheint, im Charakter und Verhalten dieser Familie romantische Schwärmerei, Neugier und Naturliebe mit Ernst, Disziplin und dem, was man heute als „konservative Werte“ bezeichnet. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren diese Menschen also weder beschränkte Philister, noch realitätsferne Träumer. Es äußert sich auch an den Berufen der Familie. Die Frauen nachfolgender Generationen heirateten – wenn sie nicht gerade Ingenieure heirateten, um so die Familie fortzusetzen – zwar Juristen oder Ärzte, aber auch Künstler. In den Heiraten zwischen Industriellennachfahrin und einem Vertreter des neuen Mittelstandes zeigt sich eine Verflechtung dieser Lebenswelten. Es bedeutet, dass die strikte Trennung à la Max Weber, wie sie einmal in einer Vorlesung zur Sozialstruktur in Deutschland, die ich besuchte, für die Weimarer Gesellschaft angenommen wurde, zumindest in dieser Familie für die Zeit 1880-1940 nicht festgestellt werden kann. Für die Frauen selbst werden in der Genealogie keine Berufe aufgeführt. Ihre Aufgabe wäre es damals gewesen, den Haushalt zu führen, die Kinder zu erziehen und den Mann bei seiner Karriere zu unterstützen. Zwischen den Partnern mochte ein erheblicher Altersunterschied bestehen. Als Marie und Julius heirateten, war sie 20, er 30 Jahre alt. Ihre Schwester Emma heiratete einen 21 Jahre älteren Mann. Aber verallgemeinern kann man das auch nicht, denn ihre Mutter war nur vier Jahre jünger, als ihr Vater und ihr Bruder heiratete eine sechs Jahre jüngere Frau. Allgemein ist aber im späten 19. Jahrhundert ein recht junges Heiratsalter der Frauen zu sehen – Marie mit 20, Emma mit 22, Lina mit 24, deren Tochter Hildegard 22. Das hört sich verdächtig an nach den Phantasien und Sehnsüchten einiger heutiger Internet-Gurus, die uns versichern, früher sei die Welt noch in Ordnung gewesen. Frauen, deren biologischer Zenit im 18. Lebensjahr wäre, hätten sich damals nicht die aberwitzige Idee ins frisierte Köpfchen gesteckt, etwas aus sich zu machen. Sie hätten früh geheiratet, sich dem Mann untergeordnet, den Haushalt geführt, viele Babys geboren – diese Leute denken immer nur an Babys, nie an Kinder reiferen Alters – und das alles hätte den Männern eine bequeme, sorgenfreie Existenz als verwöhnter Pascha gesichert. Das DHM schreibt dazu: „Ein Mann, der um 1900 die Ehe einging, war im Durchschnitt 29 Jahre alt; bei den Frauen lag das durchschnittliche Heiratsalter bei etwas mehr als 26 Jahren. Das ist zwar niedriger als das Heiratsalter zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gleichwohl aber immer noch erstaunlich hoch, mißt man es an unserem Bild von der Auflösung traditioneller Bindungen im Zuge der Industrialisierung.“ Und das bedeutete noch immer, dass relativ oft und früh geheiratet wurde, anders als in früheren Zeiten, wo eine Ehe streng an Erbe oder berufliche Etablierung gekoppelt war und längst nicht alle erwachsenen Menschen heiraten durften. Hatten sie so viele Babys? „Eine Ehe, die im Jahre 1900 geschlossen wurde, hatte im Durchschnitt vier Kinder. Nur in jeder sechsten Ehe gab es zwei oder drei Kinder und sogar nur in jeder zehnten ein einziges Kind. (Zum Vergleich: 1971 lag die durchschnittliche Kinderzahl in der Bundesrepublik bei 1,5). Das heißt, fast alle Ehepaare lebten um die Jahrhundertwende als Eltern, fast alle Kinder wuchsen mit Geschwistern heran.“ Also wurde in der Familie relativ früh geheiratet und die Kinderzahl war normal. Es muss auch bedacht werden, dass – wie im Falle von Linas Kindern – deutlich mehr geboren werden mochten, als man letztendlich tatsächlich an Kindern hatte. Die Ehe selbst hatte eine erhebliche Bedeutung. Eine Scheidung oder Trennung wurde damals noch weniger toleriert als heute. Andererseits war keinesfalls eine lange Ehedauer selbstverständlich. Um 1900 wurden tatsächlich immer mehr Paare gemeinsam alt, es war jedoch nicht selbstverständlich. Man feierte also die Silberhochzeit als beachtliche Lebensleistung und die aufholende Industrialisierung versorgte Paare und Angehörige mit Produkten zum Fest und Geschenken – etwa Myrtenkranz und Myrtenzweig aus Silberblech für das Paar, Gedenkteller und dergleichen. So war es also. Und wie sah das Brautkleid wohl aus? Laut DHM etablierte sich das weiße Brautkleid in Deutschland erst in den 1920ern-30ern. Das gilt vor allem für arme Schichten und das Land. Für die Frauen, die ich hier betrachte, mag ich mir ein recht wertvolles und elegantes schwarzes Kleid vorstellen. Es würde zu einer Familie passen, die einerseits durchaus kultiviert, andererseits aber praktisch und vom Lande ist und vielleicht so etwas vorzieht, nicht, weil ein weißes zu elegant wäre, sondern weil man auch ganz bewusst an einer Tradition festhält. Das damalige Brautkleid wäre keine Anschaffung für einen Tag gewesen, sondern ein Kleid, das man später noch an Sonntagen, Feiertagen und zu Beerdigungen tragen könnte. Und es würde vom hier so häufigen Regen und Schlamm weniger Schaden nehmen. Ich hörte noch selbst im Dorf von dem „Schwarzen Kleid“ in dem man früher geheiratet hätte. Solche schwarzen Kleider, gut erhalten, waren bei der Ausstellung „Störig“ im Kulturbahnhof vom Grevenbrück 2014 zu betrachten. Ein schwarzes Satinkleid von etwa 1900, reich an schwarzen Verzierungen, ein schwarzes Georgettekleid der 20er Jahre, noch immer recht lang und doch mit den modischen Fransen verziert, natürlich schwarzen Fransen. Die Mode änderte sich damals wegen der Industrialisierung, die einerseits neue Möglichkeiten schuf und andererseits auf Nachfrage angewiesen war, daher mochte dieses Kleid sogar umgeändert werden. „Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts begannen Anstand und Sitte die Standards zu setzen, nach denen die Menschen sich kleideten, und Achtbarkeit wurde zum Prüfstein der höflichen Gesellschaft. Eiserne Männlichkeit und züchtige Weiblichkeit waren die bevorzugten Charakterbilder, die Männer und Frauen verkörperten, während das Viktorianische Zeitalter langsam heraufzog. Um 1850 trugen Frauen Kleider mit eng anliegenden Taillen und weiten Röcken, die mit Reifröcken und Krinolinen gestützt werden mussten. In den sechziger Jahren wurden die Kleider vorne flacher, hinten jedoch zu einer Schleppe verlängert, die von einer Turnüre unterstützt wurde. Später verschwand die Turnüre und die so genannte Prinzess-Linie kam in Mode: schmale Kleider ohne Tailliennaht, mit längerem Mieder und vielen Drapieren, Bändern, Borten und Bäuschen verziert. In den achtziger Jahren wurde die Turnüre wieder populär, und zwar in einer noch extremeren Form als zuvor. Die Röcke standen hinten nahezu horizontal ab“, so steht es in Fashion Design 1800-1940. Verfolgen mochte man diese Entwicklung über eine populäre Zeitschrift, etwa den Bazar. Diese Modezeitschrift, die im Laufe des 19. Jahrhunderts diverse für das Ausland konzipierte Ableger, eine Auflage von über 200.000 Exemplaren und ab etwa 1878 den deutschen Ableger Die Illustrirte Coiffure. Modejournal für Putzgeschäfte erreichte, bot neben unterhaltsamer und zum Nachdenken anregender Literatur auch Schnittmuster, Anleitungen für Handarbeiten und dergleichen, berichtet Barbara Krautwald in ihrer Dissertation. Es bedeutet, dass man sich über Mode auf den Laufenden halten und sogar die Kleider selbst nach nähen konnte, sofern man nur Zugang zur Post hatte. Ja auch auf einem „kleinen Dorf“ musste demnach nicht die Mode von vor 50 Jahren getragen werden. Für den Oktober 1880, dem Monat von Maries Hochzeit, lässt sich doch tatsächlich ein über Wikimedia Commons bereitgestellter Modedruck finden. Nicht allein kommuniziert dieser, was eine Dame zu tragen hat, aber auch, wie sie zu sein hat: Die Dargestellte steht in einem eleganten umzäunten Garten mit hohen Gewächsen. Hinter dem Zaun, ganz im Hintergrund, weisen Bäume und ein Kirchturm eher auf ein Städtchen oder Dorf als auf eine Großstadt hin. Ein Birnbaum mit Früchten ist zu sehen, weist uns auf das Ende des Jahres ebenso hin, wie auf ein gutes, idyllisches Leben. Modisch gekleidete Mädchen umstehen die Dame, eines lehnt sich über einen Stuhl, von dem sie wohl gerade aufgestanden ist, ein anderes steht neben ihr, ein drittes hat bereits recht viele Birnen in einen Korb gesammelt und greift schon nach einer weiteren. Die Kleider der Kleinen sind dabei kürzere und lockerere Versionen der Erwachsenenmode, auch sie tragen Hüte und hohe Stiefelchen mit Absätzen, die unbedeckten Beine und halboffenen Haare weisen sie klar als Kinder aus. Die Dame selbst steht so, dass man ihre Garderobe gut bewundern kann: Die feine Spitze ihres Schuhs ragt aus ihrem sehr langen Rock hervor, was ihr geradezu etwas ätherisch Schwebendes gibt. Das Kleid ist tatsächlich eine gute Vorlage für ein schwarzes Brautkleid – wenn es auch nachtblau und nicht schwarz ist. Es ist die hochgeschlossene Tagesversion eines Kleides in Prinzessstil: Es hat schmale Ärmel und umschließt eng anliegend die erwünschte Sanduhrfigur der Dame. Nach unten weitet sich der dunkle Seidenrock nur leicht, um die untere Hüfte und das Gesäß sieht man einen Stoff mit einer eingewebten, gestreiften Borde kunstvoll drapiert und gefaltet. An Accessoires fehlte es der modebewussten Frau von damals nicht: Das Kleid ist an den mit Rüschen verzierten Halsausschnitt und den Ärmelsäumen um eine weiße Krause und weiße Ärmeleinsätze ergänzt, auch um ihre Haut vor der Sonne zu schützen, trägt die Dargestellte einen dunklen Sonnenschirm und einen Sonnenhut. Dieser ist mit einem zum Kleid passenden Stoff gefüttert, weiße Spitze leuchtet auf ihm, die dunklen Blumen und Federn, die sie ergänzen, richten sich farblich nach dem Kleid. Darunter ist das hellbraune Haar hochgesteckt, ein paar Locken fallen in den Nacken, über der Stirn ist es gescheitelt und gewellt. Von heutigen Publikationen ist man es gewohnt, nicht allein mit konsumierbaren Artikeln, aber auch mit dem damit verbundenen Frauenideal konfrontiert zu werden: Das heutige Model ist oft hoch, schmal und knochig, mit einem androgynen Touch. Obwohl sie manchmal mit ihren Blicken und Posen Verführung suggerieren soll, wirkt ihr Blick oft leer und roboterhaft. Die Frau in dem Modedruck von 1880 wirkt anders: Sie wirkt zart und ätherisch – die Finger unendlich schmal und fein, die Gestalt ist schlank, was aber eher von einem zierlichen Skelett, als von kümmerlicher Ernährung herrührt. Das Haar ist weich, ebenso der Umriss des wohl ernährten Gesichtes – die ideale Frau war kurvenreich, zierlich, gesund und kuschelig, ihr verträumter, sich in die Ferne wendender Blick samtig weich, wie ihr Haar. Zusammen mit der Umgebung, ihrer Haltung, dem Kreis kleiner Mädchen, den sie um sich schart, dem nach außen abgegrenzten Garten und dem Stuhl, den sie eben verlassen hat, vertritt die Dargestellte das Frauenideal des Bürgertums: Sanfte Ruhe stahlt sie aus, Wärme, aber auch ein duldsames Gemüt. Sie ist familienorientiert, hält sich zu ihrem Geschlecht, sie ist im Haus, „behütet“ hinter Mauern, Zäunen, Portieren und Wänden, sie ruht in sich, sie träumt, sie liebt. Das Bild erinnert in seiner Symbolik – wenn auch zufällig – an das Design von Maries Grabstein – die Frau umgeben von einer schützenden Mauer, die dick und robust genug ist, sie von der Außenwelt abzuschirmen. Barbara Krautwald allerdings meint, dass dieses Ideal vor allem das blieb – ein Ideal. So sei das Bürgertum im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in Deutschland angewachsen, potentielle Heiratskandidaten steckten längere Zeit in der Ausbildung fest. Wenn auch das Bürgertum eine Mischung aus Liebesheirat und arrangierter Ehe vorzog, mochte eine zu kleine Auswahl an Bewerbern, oder auch die Angst, letztlich gar nicht zu heiraten, in unglückliche Ehen führen. Auch das Ideal der Dame des Hauses, die – finanziell durch den Mann versorgt und durch Bedienstete entlastet – als Herz der Familie in der Ruhe des Hauses sich kunstvoller Textilarbeit widmen und Liebe und Harmonie um sich verströmen mochte, wurde oft nicht wirklich erreicht. In der Regel würde auch die bürgerliche Hausfrau Hausarbeit verrichten und nicht selten mochte sie fleißig sticken, nähen und stricken, angeblich für die Familie oder Bedürftige, um die Produkte dann diskret an Modegeschäfte zu verkaufen. Im Gegensatz zur Arbeiterfrau würde für die Frau des Bürgertums die Arbeit aber nie ihre Identität ausbilden, oder ihren Stolz stützen – im Gegenteil. Harte, zielorientierte Arbeit galt für diese Damen als Schande und musste verborgen werden, ebenso wie ein vielleicht bescheidener Lebensstandard mit prachtvoller Repräsentation kaschiert werden musste. Christoph Kucklick untersuchte die um 1800 in der deutschen Philosophie entwickelte Vorstellung vom Verhältnis der Geschlechter zueinander, das er nicht hierarchisch, sondern heterarchisch versteht. Laut jener hängt die ganze soziale Ordnung an dieser Frauenrolle: „In geradezu postmoderner Metaphorik skizzierte [Carl Friedrich] Pockels die -losigkeit [den unbegrenzten Individualismus] dieses Wesens. Denn ein solches [immer männliches] ich sei nichts als „ein im leeren Raum schwebender Riß ,- nichts als ein Stück kalter Vernunft, dem noch die höheren Antriebe des Wirkens, - das Herz, fehlten, dem noch die gesellige Liebe unbekannt war, - ein schrecklicher Widerspruch mit sich selbst und der gesamten Natur.“ Die formale, negative Natur der Männlichkeit stand bei Pockels im Gegensatz zur traditionellen, zweckgesättigten „gesammten“ Natur, die stets mit (weiblichem) Herz gefüllt sei. […] Der „schwebende Riß“ namens Männlichkeit aber schmerzte […] [d]enn im Riß verbirgt sich der pure Selbstbezug, oder, wie es bei Pockels heißt, „der ideale Egoist.“ Auch andere Denker zeichneten den Mann als von Geburt an erst einmal von Gewalt, Macht und Sex besessenes Wesen, das durch die Frau, genauer die Frau mit der er verheiratet war, zum geselligen und moralischen Menschen gezähmt werden musste – paradoxer Weise, indem sie ihm mit besonderer Weichheit, Unterordnung, Passivität und Aufopferung begegnete. Der Soziologe zitiert auch Daniel Jenisch, der den Mann ohne weiblichen Einfluss doch tatsächlich als wildes, brutales, unbeherrschtes haariges Monster beschreibt, als „Thier=Mann.“ Eben jene samtig-weiche, verträumte und gleich einer Porzellanfigur zerbrechliche Frauengestalt, wie sie auf dem Modedruck des Bazar zu sehen ist, ist als die Falle gedacht, in der sich dieses haarige, wilde Thier fangen soll. Ohne Worte, Kommandos oder direkte Lehre, ja ohne tatsächliche Macht, bewaffnet mit Liebe und Herz soll sie den Thier=Mann zum Menschen dressieren. Diese Ideologie engte Frauen natürlich zunächst ebenso ein, wie sie Männer abwertete, aber die neue Vorstellung, Frauen seien nicht einfach kleinere Männer, sondern hätten ein eigenes Wesen und der Welt etwas zu geben, womit kein Mann sie versorgen könnte, war tatsächlich eine wichtige Vorläuferin des Feminismus. Im Lehrbuch „Das Weib als Gattin“ schreibt der Arzt Hermann Klencke von einem großen Gegensatz zwischen den Geschlechtern: „Der Mann ist mehr individuelles, das Weib mehr Gattungswesen; er Verstand und Charakter, es Gefühl und Schwäche“, bestimmt einem „Geschlechtsberuf[...]“ und doch schreibt er sie auf der selben Seite: „In diesem naturwissenschaftlichen Sinne wird das Weib, dem Manne gegenüber, sich nicht herabgesetzt, sondern gehoben fühlen, als eine heilige Priesterin der Natur, eine Erhalterin des Familienlebens und der Menschheit […]“, vorher noch hat er tatsächlich schlechte Männern als „geistesstumpfe[n] Sclaven ihres eigenen, bilden, thierischen Naturtriebes […]“ bezeichnet, und schreibt weiter: „Und auf diese großen Pflichten im Dienste der Menschheit stützen sich auch die Rechte des Weibes, die seine Schwäche mit Schonung und Milde zu tragen, dem Mann und den Staat zu seinem Schutze verpflichten, und den Beruf des Weibes als Gattin für einen heiligen halten.“ Die Frau hat also nicht voll Anteil an der Existenz als menschliches Individuum, aber für diese Unterordnung schulden Mann und Staat ihr Schutz. Es ist in den Augen des Arztes kein Widerspruch, von der Frau zugleich das Überleben der ganzen Menschheit abhängen zu lassen und sie zugleich als schwach zu sehen. Aber immerhin ist sie heilig. Es ist der typische patriarchale Deal: „Women always shared the class privileges of men of their class as long as they were under „the protection“ of a man. For women, other than those of the lower classes, the „reciprocal agreement“ went like this: in exchange for your sexual, economic, political, and intellectual subordination to men you may share the power of men of your class to exploit men and women of the lower class“, schrieb Gerda Lerner 1986. Also „Schutz“ gegen Unterordnung. Wie stand es nun tatsächlich um die Rechte des Weibes, etwa in der Ehe? Westphalen war im späten 19. Jahrhundert Teil Preußens, später natürlich des deutschen Kaiserreiches. Im Allgemeinen Landrecht von 1794 regulierte der Staat Ehe und Sexualität, sowie die Rechte und Pflichten von Kindern und Eltern gegeneinander bis ins kleinste Detail und schrieb eine patriarchale Eheform fest. Ja, wer meint das Familienleben sei früher privat gewesen, sollte wirklich mal einen Blick in einen beliebigen Gesetzeskodex wagen. Es heißt etwa: „§. 184. Der Mann ist das Haupt der ehelichen Gesellschaft; und sein Entschluß giebt in gemeinschaftlichen Angelegenheiten den Ausschlag“, oder auch: „§. 192. Die Frau überkommt durch eine Ehe zur rechten Hand den Namen des Mannes. §. 193. Sie nimmt Theil an den Rechten seines Standes, so weit dieselben nicht allein an seine Person gebunden sind.“ Er schuldet ihr Unterhalt, sie ihm die Führung des Haushaltes. Ein Gewerbe darf sie ohne ihres Mannes Einwilligung nicht betreiben. Es geht hier vielleicht weniger um Erlaubnis oder Gehorsam und mehr darum, dass die Frau nicht als eigenständiger Mensch, sondern als Ergänzung und Anhang des Mannes gedacht wird. Das Paar wird eine Einheit, diese Einheit aber ist der Ehemann. Sie wird in ihm subsumiert, nicht anders, als Eva, Adams kleine, krumme Rippe. Sie wird Frau Ihr Ehemann, so wie die Prinzessin George, die Weißin, oder Frau Amtsrichter Wissmann. Andererseits darf sie allein, da sie einen Mann geheiratet hat, sich mit dessen Titeln, Leistungen und Rang schmücken, ohne je etwas dafür geleistet zu haben. Ihre eigenen Leistungen aber sind unsichtbar, ummauert und umzäunt in der Privatsphäre, denn – erinnern wir uns – im Bürgertum des späten 19. Jahrhunderts hat die Frau nicht mehr so viel Anteil am Betreiben des Gutes, des Bauernhofes, der höfischen Stellung oder des Gewerbes, wie noch in der Ständegesellschaft des 18. Sie hat eine eigene Rolle und die MUSS hinter Mauern und Zäunen verborgen sein. Und wie verborgen diese Rolle ist, so entwertet ist sie auch, meint immerhin Evke Rulffes. Es habe zwar im Deutschland des 16.-19. Jahrhunderts eine patriarchale Gesellschaft gegeben, die etwa aus der Bibel ableitete, jede Frau sei Gehilfin des echten Menschen, des Mannes. Aber die gelebte Realität wich doch oft vom durch Staat, Gesetz und Kirchen propagierten Ideal ab. Ab dem 16. Jahrhundert wurden viele Frauen aus dem Handwerk durch den Zunftzwang verdrängt. Und doch gab es weibliche Zünfte und es gab in der Höfe umgebenden Luxusindustrie viele Künstlerinnen, Kunsthandwerkerinnen, Hoflieferantinnen. Natürlich beschränkt sich das Verhältnis der Geschlechter nicht auf „Frauen müssen zuhause bleiben“ versus „Frauen dürfen arbeiten gehen“. Aber es zeigt sich, dass Frauen auch damals nicht bloß Ehefrauen oder Mätressen waren und „Schwäche“ oder mindere Intelligenz wurde Frauen nicht umbedingt unterstellt. Es war weniger von Unterordnung die Rede und auch der nachgeordnete Status der Frau hing mit der gesellschaftlichen Ordnung zusammen. Die Rolle einer Ehefrau war auch eine andere: Das „Ganze Haus“ mag eine Fantasie des NS-Regimes und des 19. Jahrhunderts sein. Aber Arbeit und Leben fand vor 1800 oft in Gut, Betrieb oder Hof statt, jeweils geführt von den Hauseltern. Ursprünglich teilten wichtige Standesgrenzen die Hausmutter von der Magd und es musste dafür argumentiert werden, dass die erstere – um Geld zu sparen – mit ihren Töchtern selbst spinnen sollte, statt Karten zu spielen. Ende des 19. Jahrhunderts sieht Evke Ruffles in bürgerlichen Familien eine ganz andere Situation. Im zum trauten Heim stilisieren Haus findet sich die Küche – der Ort, an dem die Wäsche gewaschen, heißes Wasser erzeugt, gewaschen, gebadet wird, neben anderen Dingen – oft als dunkler, schlecht gelüfteter, enger Raum irgendwo in der Peripherie des Hauses oder der Wohnung. Das Schaustück des Zuhauses ist der Salon, der der Autorin zufolge prachtvoll eingerichtet ist – entsprechend aufwendig zu pflegen – der aber ausschließlich zum Empfang von Gästen dient. Das Leben der Dame des Hauses entspricht demselben Spagat, den auch der Haushalt als Ganzes vollzieht: Die Gastessen, die den sozialen Erfolg des Paares und den beruflichen Erfolg des Mannes stützen sollen, sollen luxuriös sein, um Reichtum vorzutäuschen. Dazu mag ein teurer männlicher Diener gemietet werden, ebenso das Silberbesteck, das nach dem Abwasch in kaltes Wasser gelegt wird, damit niemand merkt, dass man die gleichen Stücke mehrfach hintereinander nutzt. Im Alltag wird streng gespart und ein „Mädchen für alles“ unterstützt die Dame bei den Arbeiten, die um 1880 noch immer ohne die uns heute vertrauten Geräte und Putzmittel erledigt werden müssen. Das mochte bedeuten, dass jenes „Mädchen“, von ihrem freien Tag abgesehen, unermüdlich schwer arbeitete, aber es mochte auch bedeuten, dass die Dame des Hauses selbst kochte, einkaufte, nähte, buk, Wäsche wusch und Kleider bügelte. Es mag sein, dass sie sich die feineren Arbeiten aufhob, sich der Arbeit aber nicht entziehen konnte. Sowohl die Hausarbeit, als auch das Anfertigen von Textilien für den Verkauf, was ich bereits erwähnt habe, mussten verborgen werden. Vor den Gästen und Freunden sowieso, manchmal aber auch vor dem Ehemann. Das nächste Paradox, das die Autorin schildert, ist das der Hausfrau, die zwar den Haushalt führen soll, aber dann ein zu kleines Haushaltsgeld zugeteilt bekommt, da der Mann gar nicht weiß, was im Haus alles stattfindet. Es ist das damalige Pendant zu den Vielen, die sich ein teures Luxusauto leisten, dafür im Alltag frieren, schlecht essen, kalt duschen, die schlecht gekleidet sind und die sich über all’ jene lustig machen, die es umgekehrt tun. „Mädchen für alles“ dürften sich in Grevenbrück hinreichend gefunden haben, gerade nachdem es angewachsen war. Ein Jahr nach Maries Geburt, 1861, wurde die Ruhr- Sieg-Strecke fertiggestellt, der Ort wuchs, Industrie siedelte sich an, villenartige Häuser mit großen Gärten vermehrten sich zwischen den alten Fachwerkhäusern, ebenso die Fabriken. Töchter aus den dazugehörigen Arbeiterfamilien mochten in einer Fabrik oder einem Haushalt harte Arbeit für wenig Geld finden. Ab einem gewissen Alter würden Maries Töchter auf die Schule geschickt werden, die es in Förde gab. Sie befand sich in unserem jetzigen Pfarrheim, was praktisch war, war der Lehrer ursprünglich zugleich der Küster gewesen. Das hatte sich natürlich gewandelt und für die 1880er und 1890er Jahre lassen sich in der Chronik die Lehrerinnen Ida Schmalrohr, Gertrud Becker und der Lehrer Engelbert Picker ausmachen. Frauenbildung, meint Sylvia Schraut, war zu Maries Zeiten ein jämmerlich kränkelnder Keim. Das 19. Jahrhundert hatte zwar zu einer Bildungsexpansion geführt, diese aber betraf – ob sie nun „profitierten“, oder sich eher über ihre Hausaufgaben ärgerten – vor allem die Jungen. Andererseits war dieser Zustand nichts mehr, was man einfach kritiklos hinnahm. Bald nach der Reichsgründung 1871 kamen in den 70ern, 80ern und 90ern des 19. Jahrhunderts in der neuen, von immer mehr Technik und Kommunikation geprägten Welt viele soziale Fragen ins Gespräch. Eine davon war die der Frauenbildung. „Einen Meilenstein auf dem Weg zur weiblichen Chancengleichheit im Bildungsbereich stellte eine Petition an das preußische Unterrichtsministerium aus dem Jahr 1887 dar. Verantwortlich zeichnete eine Reihe Berliner Frauenrechtlerinnen um Marie Loeper-Housselle, die Herausgeberin der Zeitschrift Die Lehrerin in Schule und Haus, darunter die Pädagoginnen Henriette Schrader, Minna Cauer und Helene Lange. Sie forderten „daß dem weiblichen Element eine größere Beteiligung an dem wissenschaftlichen Unterricht auf Mittel- und Oberstufe der öffentlichen höheren Mädchenschulen gegeben“ werde und den Aufbau staatlicher Ausbildungseinrichtungen für Lehrerinnen in den Oberklassen höherer Mädchenschulen“, schreibt Sylvia Schraut. Wie die Reaktion vor Ort auf diese sozialen Fragen und Bewegungen ausfiel, ist schwer zu sagen. Es gab Frauen, die dergleichen Vorstöße konsequent ablehnten, wie es sie auch heute gibt. Andererseits war gerade das andere und edler gedachte Wesen der Frau ein gutes Argument für einen stärkeren Einfluss der Frau in der Gesellschaft, für seine Notwendigkeit. Natürlich war diese Debatte zu Maries Zeiten noch jung und hatte sich vielleicht nicht überall hin ausgebreitet. Vielleicht war es aber auch so, wie Josef Boerger das Jahr 1848 in Grevenbrück beschreibt: „Thomas Huster, Kaspar Schulte-Hammelmann und Joh. Reuber waren 1848 die Hauptrevolutionäre von Förde. Sie sollen den Predigtstuhl aus der Kirche geholt und auf dem Kirchhof aufgestellt haben. Kaspar Schulte hat dann eine Rede vom Kirchturm gehalten und einen Demonstrationszug zum Amtmann Hartmann in Bilstein gefordert. Die Bauern haben aber vorgezogen, auf Kosten des Gewerken Wilhelm Hüttenhein von Gräfenmühle an jenem Abend ein Branntweingelage in Fischers Wirtsstube zu halten und den Zug nach Bilstein auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Der äußere Anlaß zu den Unruhen von 1848 in unserer Gegend lag im Versagen der Getreideernte von 1847. Das Sauerland war genötigt, große Mengen Roggen vom Hellweg einzuführen.“ Oder vielleicht ist das Leben auf dem Lande nicht langsamer und veralteter, sondern einfach anders. Es wäre auch schwierig gewesen, sich in Grevenbrück zu vernetzen und zu engagieren. Auch heute hat das Dorf eine Sozialstruktur, die aus etlichen in sich sehr geschlossenen Cliquen besteht, die untereinander nichts verbindet, die sich gegeneinander abschotten und aneinander vorbei leben. Dasselbe Bild liefert in meinen Augen auch die Chronik, deren Bild von Grevenbrück fast ausschließlich von den alten, katholischen Bauernfamilien dominiert ist. Dagegen entstammte Marie dem Bürgertum und war evangelisch. Wie klein die evangelische Community in Grevenbrück ist und wie klein sie damals war, das mag die Größe des alten und neuen Friedhofes bezeugen. Da fällt mir wieder die in Stein gemeißelte Inschrift ein: „Unserer unvergesslichen Tochter […]“. Sie wird sich vor allem eng an ihre Familie gehalten haben und sicherlich waren ihre Eltern froh, dass sie mit ihrem Mann und ihren Kindern im selben Ort wohnte. Eine große Nähe offenbart sich in der Inschrift, eine Nähe, die auch eine sinnvolle Reaktion einer aus ihrem ursprünglichen Habitat herausgerissenen Enklave auf ihre Lebensumstände ist. Man stillt sein Bedürfnis nach Nähe, indem man einfach aus dem, was man an sozialen Kontakten hat, das beste macht. Und doch – sofern Marie oder Lina den Bazar lesen würden, würden sie zwangsläufig mit den neuen sozialen Fragen konfrontiert. Barbara Krautwald beschreibt, wie sich der Bazar auch bereits vor 1871 mit Frauenbildung, Frauenerwerbstätigkeit und der Frauenfrage auseinandersetzte. Da mochte es einmal beklagt werden, welches unnatürliche Leben die Fabrikarbeiterin führt und dass es noch ein weit größeres Übel sei, wenn gebildete Frauen des Bürgertums eine Arbeit ergriffen. Oder es wird darüber gelästert, dass junge Frauen, nach der Erziehung durch die Mutter und der Bildung durch die Töchterschule, sich als unbeholfen im Haushalt erwiesen. Das mag die damals geforderte weibliche Berufung ebenso widerspiegeln, wie den Umstand, dass auch damals die böse, böse Jugend als faul, inkompetent und wenig belastbar wahrgenommen werden konnte. Aber es werden auch Paradebeispiele weiblicher Bildung präsentiert, ein Mittelweg zwischen Untätigkeit und einem der Erwerbstätigkeit ganz gewidmeten Leben vorgeschlagen, oder die engen geistigen Grenzen damaliger Damen kritisiert. Zu Maries Zeiten aber wechselte der Bazar den Besitzer und sah sich mit der Reichsgründung und der Politik Fürst Bismarcks konfrontiert. Die Zeitschrift wurde konservativer, patriotischer und propagierte die mit Sparsamkeit und Näharbeit beschäftigte Hausfrau. Und dennoch zitiert Barbara Krautwald den Bazar so: „Mit Stolz schauten die ältere Teilnehmer des schönen Festes auf den jugendlichen Doktor der Philosophie in Mädchengewändern […] und in hunderten von starken strebenden Mädchenherzen regte sich der Wunsch, der Entschluß, sich gleich Ellen Fries den Lorbeerkranz durch ernste Geistesarbeit zu erringen.“ Es scheint, als müsse man die damalige Position zu solchen Gesellschaftsfragen als Diskussion und nicht als brutalen, selbstgerechten Streit begreifen. Wir sind es aus unserer Zeit allzu gewohnt, unsere Position zu einer Frage nicht bloß für unser Eigeninteresse zu halten, sondern für die einzig richtige, einzig moralische, gute Entscheidung. Die Wokeness ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Aus den Diktaturen des 20. Jahrhunderts und dem Kalten Krieg scheint uns noch immer der Hang zum Kollektivismus und zur Konformität anzuhaften. Als könne man sich nur für eines von zwei Extremen entscheiden und das „gute“ Extrem sei für alle Recht. Natürlich gab es auch damals Konformität, aber ich denke doch, dass wir heute engstirniger und intoleranter sind, als wir es je von uns selbst annehmen würden. Im damaligen Bazar scheint es Raum zu geben für Ausnahmen und dafür, das Menschen verschieden sein dürfen. Natürlich muss Marie sich nicht für diese sozialen Fragen interessiert haben, sondern eher für die Berichte über Mode, die Schnittmuster und die Vorlagen für Handarbeiten. Auch in der heutigen Burda sind Artikel, die man lesen kann, Basteltipps, Zeitgeist, Lifestyle und Ähnliches und mögen übergangen werden, während man lieber die Abbildungen der Modelle betrachtet und die Schnittmuster überträgt. Der Bazar erschien wöchentlich. Auf einen Tag nach dem letzten Geburtstag, den Marie auf Erden erleben sollte, ist die Nr. 13 des Jahres 1889 datiert. Der erste Artikel kommentiert im fröhlich-freundlichen Tonfall typisch für die Zeit – es fällt mir immer auf, wie diese Menschen, die echte Probleme hatten, wie Kriege und Seuchen, sich mit aller Kraft auf das Schöne und Positive konzentrierten, die Frühjahrstoilette. „Da die Jugend das Recht hat, dem Neuen nachzustreben, so will ich nur gleich die hübschen losen englischen Paletots betonen […] die entweder mit nach außen umgelegten gestickten Revers offen oder mit Patten geschlossen getragen werden.“ Ausführliche Abbildungen zeigen die Kleider mit den Frisuren an abermals idealen Frauenfiguren mit verträumtem Blick, schmaler Taille und feinen Händen in häuslichen Settings, umgeben von Zimmerpflanzen und Vorhängen. Die Frauen leisten einander Gesellschaft in ruhige Gespräche vertieft, es sind auch ein paar Mädchen dabei. Die ideale Frau ist nicht nur häuslich und sanft, sie beschränkt sich auch auf die weibliche Sphäre und lebt unter Frauen. Eine Doppelseite, auf der eine Gesellschaft von Frauen und Mädchen in einem Garten dargestellt ist, samt eines Mädchens, das einen Schwan herzt, dient zur Darstellung aller Modelle, die als Schnittmuster in der Zeitschrift enthalten sind. Weiter sind auch modische Hüte und Frisuren abgebildet, schließlich Muster für Handarbeiten. Da ist ein Muster für eine Stickerei zu einer Decke, die noch um eine Häkelfranse ergänzt wird. Oder eine Häkelspitze, ein Lampenteller, aber auch ein Muster für ein kompliziertes Gardinenarrangement, dessen weiße innere Vorhänge mit einer aus Bänderspitze bestehenden Blütenranke dekoriert sind. Das Muster wird auf einer Abbildung detailreich abgebildet. Damit mochte man etwas Geld für den Haushalt erwirtschaften, etwas für den Haushalt selbst produzieren, oder sich auch einfach nur vergnügen. Handarbeiten sind entspannend und meditativ und ich lade uns ein zu bedenken, dass Maries Welt eine ohne Radio, Platten, Fernseher, Streamingdienste und Soziale Medien war. Statt Tippen also Sticken oder Häkeln, statt WhatsApp Briefe und Besuche. Im April werden schon die Schauer über die Berge des Sauerlandes gegangen sein und sich mit Lichtblicken glänzenden Sonnenscheins abgewechselt haben. Der Liebespfad wird sich schon mit den ersten grünen Blättchen und Blumen bedeckt haben. Dann wurde es warm und feucht, unterbrochen von den hier typischen Kältephasen – Schafskälte, Eisheilige und dergleichen. Dann war Juni und die Zeit ihrer nächsten Niederkunft kam näher. Freute das Paar sich, oder sah es sich gestresst den Kosten eines weiteren Kindes gegenüber? Die anderen drei hatten ja gut das Säuglingsalter und die Kinderkrankheiten überlebt. Hofften sie darauf, dass es ein Junge werde? Wollte Julius einen Sohn, oder wollte Marie gar einen? Es würde eine typische Hausgeburt. „Bevor diese Entwicklung [hin zur Geburt in einer Klinik] eingesetzt hatte, war der Gebärenden in der Regel von weiblichen Familienangehörigen, Freundinnen und Nachbarinnen, die beim Einsatz der ersten Wehen in der Wochenstube der Kreißenden zusammenkamen, Beistand geleistet worden. Die Frauen beruhigten die Gebärende, sprachen ihr Mut zu und regelten die praktischen Dinge, wie das Geburtslager zu richten, für eine geeignete Raumtemperatur zu sorgen, Essen und Getränke zuzubereiten, das Neugeborene zu versorgen usw. Der Nachbarin oder Freundin bei der Niederkunft wechselseitig beizustehen, war eine Selbstverständlichkeit, der sich keine verheiratete Frau entzog. Auf dem Lande bildeten die verheirateten Frauen eine praktische geburtshelferische Hilfsgemeinschaft. Männer hatten zu der Geburtsstube zumeist keinen Zugang. Lediglich wenn sich eine schwierige Geburt ankündigte, wurde der Ehemann hinzugezogen, um der Gebärenden physisch und psychisch beizustehen. Innerhalb dieser Hilfsgemeinschaft nahm die Hebamme eine zentrale Rolle ein. Die Gemeinde- oder Amtshebamme wurde von den verheirateten und verwitweten Frauen einer Gemeinde gewählt. Die Hebammenwahl war ein Teil der dörflichen Frauenöffentlichkeit und zugleich das einzige öffentliche Wahlrecht der Frauen“, schreibt Marita Metz-Becker. Also waren vielleicht Lina und Henriette bei Marie, standen ihr bei, machten ihr Mut. Vielleicht haben sie und Julius noch ein paar letzte, tröstende Worte gewechselt. Aus der Aussage der Hebamme, Maria Möller, die ich gefunden habe, geht nicht hervor, Marie wäre zeitgleich mit ihrem Sohn gestorben. Vielleicht starb sie etwas später, aber sie verließ diese Welt am selben Tag, dem 9. Juni. Wie damals üblich, würde sie für das Begräbnis hergerichtet und zu Hause aufgebahrt werden. Es würde eine Beerdigung stattfinden, ob ein Pfarrer dazu anreisen musste, weiß ich nicht, allenfalls gab damals noch keine evangelische Kirche in Grevenbrück. Und dann wurde der Sarg auf die Hardt gebracht, um schließlich in der Grabstelle im Familienfriedhof zu verschwinden. Später wurde der Grabstein bei einem örtlichen Steinmetz bestellt und kam auf das Grab. Dann sollten sich die Reihen des ursprünglichen Familienfriedhofs füllen, mit Maries kleinen oder jungen Neffen und Nichten. Ihr gegenüber fanden ihre Nichte Erna, ihre Eltern und schließlich Maries Bruder und Lina ihre letzte Ruhe. Und so schließe ich meine Suche nach dem Leben hinter einem Grabstein auf der grevenbrücker Hardt ab. Dem Gedenkstein einer Frau des späten 19. Jahrhunderts, einer Tochter ihrer Zeit. Natürlich ist alles, was ich hier geschrieben habe, mit äußerster Skepsis zu betrachten. Es ist oft so, wenn man über einen Menschen der Vergangenheit forscht, man fast nichts über diesen Menschen findet. Man muss also ganz viel rekonstruieren und forscht eher nach so einem Menschen, statt nach diesem Menschen. Und so sagt das, was ich hier geschrieben habe, mehr über mich aus und über die Zeit, in der Marie lebte, als über sie selbst. Und dennoch hoffe ich, ich habe ihr nicht allzu viel Unrecht getan.
Die Hauptquelle wäre der Grabstein selbst. Die rechtlichen Quellen und Literaturtitel sind in der Reihenfolge ihrer Ersterwähnung im Text gehalten.
(2025)
https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/ Laudatio_Turiae_Wistrand.htm (Montag, 10. März 2025)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104410/umfrage/ entwicklung-des-umsatzes-im-bestattungsgewerbe/ (Montag, 10. März 2025)
https://recompose.life/ (Montag, 10. März 2025)
https://aquamation.de/ (Montag, 10. März 2025)
Dahm-Arens, Hildegard. "Die Böden des Massenkalkes von Attendorn."
Decheniana 139 (1986): 384-394.
Stadtarchiv Lennestadt (Geburts- und Sterbebücher, Heiratsregister Förde)
Die Familie Huettenhen Hüttenhain Hüttenhein, 2. Aufl., Vorländer, Siegen 1940, (1. Aufl. 1910).
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/1900_1.htm (Donnerstag, 13. März 2025)
Rudolf Gericke, Familien- und Wirtschaftsgeschichte am Beispiel der Familie Hüttenhein in Grevenbrück, in: Jahresheft des Heimat- und Verkehrsvereins e.V. Grevenbrück, Nr. 12, Lennestadt-Grevenbrück 1993, Heimat- und Verkehrsverein e.V. Grevenbrück (Hrsg.).
Josef Boerger, Tausend Jahre Förde-Grevenbrück, 1946, Ruegenberg, Olpe, Digitalisat: Herbert Kuba, Bochum 2006.
https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/lebensstationen/1900_8.htm (Samstag, 15. März 2025)
Joost Hölscher, Dorine van den Beukel (Einleitung), Fashion Design, The Pepin Press Amsterdam, 2000.
Krautwald, Barbara. Bürgerliche Frauenbilder im 19. Jahrhundert: Die Zeitschrift »Der Bazar« als Verhandlungsforum weiblichen Selbstverständnisses. transcript Verlag, 2021.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/ Der_Bazar,_Illustrirte_Damen-Zeitung,_1_October_1880,_RP- P-2009-2786.jpg (Samstag, 15. März 2025)
Kucklick, Christoph. "Das unmoralische Geschlecht." Zur Geburt der Negativen Andrologie, Frankfurt aM (2008).
Dr. med Hermann Klencke, Das Weib als Gattin., 14. Aufl. neu bearbeitet von Prof. Dr. R. Klencke, Leipzig 1897, Verlag von Eduard Kummer, 1. Aufl. 1872.
Lerner, Gerda. The creation of patriarchy. Vol. 1. Oxford University Press, 1986.
https://opinioiuris.de/quelle/ 1623#Vierter_Abschnitt._Von_den_Rechten_und_Pflichten_der_Eheleute_ in_Beziehung_auf_ihre_Personen (Sonntag, 16. März 2025)
Rulffes, Evke. Die Erfindung der Hausfrau–Geschichte einer Entwertung. HarperCollins, 2021.
Prof. Dr. Sylvia Schraut (2024): Mädchen- und Frauenbildung, in: Digitales Deutsches Frauenarchiv.
URL: https://www.digitales-deutsches-frauenarchiv.de/themen/maedchenund-frauenbildung
Zuletzt besucht am: 21.03.2025.
Der Bazar, Nr. 13, 1. April 1889, https://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ihd/periodical/pageview/2995935 (Sonntag, 23. März 2025).
Metz-Becker, Marita. "Drei Generationen Hebammenalltag." (2022).
https://www.lennestadt.de/media/custom/2080_1826_1.PDF?1399287690 (Samstag, 22. März 2025)
https://grevenbrueck.de/blog/2017/01/04/mit-dem-totenwagen-durch-die- felder/ (Donnerstag, 27. März 2025)