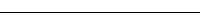von Annika Ehl
Grüne, saftige Wiesen, Wälder, soweit das Auge reicht – nein, wir sind nicht im Allgäu, und es ist auch nicht eine Umschreibung für Tolkiens Auenland. Wir befinden uns im Oberbergischen Land, genauer noch in der ältesten Stadt des bergischen Landes: Wipperfürth. Neben rund 23.000 Einwohnern wohnt hier aber noch eine Seltenheit: eine Geige. Im ersten Moment vielleicht nichts Besonderes, aber die Geschichte dieser Geige, bzw. ihres Erbauers, ist eine wirklich ungewöhnliche, die einen nicht unberührt lässt.
Rudolph Fischer wurde am 9. November 1924 im ehemaligen Sudetendeutschland geboren. Er war der Sohn eines Schreiners, hatte also schon immer Kontakt zu Holz gehabt. „Ein bisschen Holzverstand habe ich auch“, erklärt mir Fischer während unseres Gesprächs. Er kannte die Unterschiede zwischen hartem und weichem Holz und bekam auch das grundlegende Zimmermannhandwerk mit auf seinen Weg.
Aber es kam eine schwere Zeit auf den jungen Mann und viele seiner Freunde zu. 1938/39 annektierte Hitler Regionen der Tschechoslowakei, unter anderem das Sudetengebiet, und viele junge Männer wurden eingezogen. Er war einer von vielen Sudetendeutschen, die Anfang der 1940er Jahre in Nordafrika kämpften. „Am 5. Mai 1943 endete der Krieg“, erzählt mir Rudolph Fischer, als sei es erst gestern gewesen. “Und dann wurden wir nach Amerika gebracht.“ Als Kriegsgefangener landete er in Oklahoma am Washita River. Dort wurde er zu Holzfällerarbeiten eingeteilt. Und dort begann die Geschichte der Geige.
„Ich hatte immer das Bedürfnis, etwas zu tun!“ beteuert mir der inzwischen über 90jährige Mann auf die anfängliche Frage hin, warum er denn eine Geige gebaut hat. Die Idee, ein Instrument zu bauen, kam ihm, als einige der anderen Gefangenen versuchten, Mandolinen aus alten Apfelsinenkisten zu bauen. Die mit Nägeln zusammen gehaltenen Kisten gaben jedoch keine wohltuenden Klänge von sich. „Mein Nachbar ging mir so auf die Nerven, da hab ich sie kaputt geklopft“ schmunzelt er mich an. Fischer gab Ihnen den Tipp, die Klampfen nicht mit Nägeln zusammenzuhalten, sondern mit Leim. Schon war er engagiert und sollte sein Können unter Beweis stellen.
Ein anderer Mitgefangener bemerkte auch seine Fingerfertigkeit und sein Holzgeschick und bat ihn daraufhin, ihm eine Geige zu bauen, um diese dann hin und wieder spielen zu können. Allein aus der Erinnerung – in der Schule hatte er mal eine in der Hand gehalten – fing er an, nach verwertbarem Holz Ausschau zu halten. Er erinnerte sich daran, dass die Decke aus weichem Holz sein musste, damit die Schwingungen der Saite über den Steg in das Innere des Geigenkörpers transportiert werden konnte, und dass der Boden aus hartem Holz sein musste, zum Beispiel Ahorn, um den Widerstand und die Stabilität zu leisten. Für das Griffbrett war noch härteres Holz aus dunklem Nussbaum erforderlich, um die Saiten durch den Druck der Finger verkürzen und somit unterschiedliche Töne spielen zu können.
 Rudolph Fischer hielt also von da an die Augen offen, um irgendwie verwertbare Holzteile einzusammeln. Was sich vielleicht simpel anhört, war eine nicht ungefährliche Schwierigkeit. Wenn er ein Stück gefunden hatte, musste er das Holz nach der Arbeit ins Lager schmuggeln. Die amerikanischen Soldaten durchsuchten die Arbeiter nach jedem Arbeitstag, damit keine Waffen oder wertvolle Gegenstände ins Lager gebracht werden konnten. Er fand ein passendes Stück Holz, aber es wurde ihm abgenommen. Einer der Offiziere war kulturbegeistert und dem Häftling wohl gesonnen. Ihm gefiel die Idee, dass Fischer eine Geige bauen wollte, und bekam mit, dass er ein passendes Stück Holz gefunden hatte. Fischer durfte es behalten.
Rudolph Fischer hielt also von da an die Augen offen, um irgendwie verwertbare Holzteile einzusammeln. Was sich vielleicht simpel anhört, war eine nicht ungefährliche Schwierigkeit. Wenn er ein Stück gefunden hatte, musste er das Holz nach der Arbeit ins Lager schmuggeln. Die amerikanischen Soldaten durchsuchten die Arbeiter nach jedem Arbeitstag, damit keine Waffen oder wertvolle Gegenstände ins Lager gebracht werden konnten. Er fand ein passendes Stück Holz, aber es wurde ihm abgenommen. Einer der Offiziere war kulturbegeistert und dem Häftling wohl gesonnen. Ihm gefiel die Idee, dass Fischer eine Geige bauen wollte, und bekam mit, dass er ein passendes Stück Holz gefunden hatte. Fischer durfte es behalten.
Aber 1945 wurde sein Vorhaben unterbrochen: Er bekam Typhus und daraufhin eine Hirnhautentzündung. Er hörte im Krankenhaus Radio und bekam so mit, dass der Krieg in Japan zu Ende war.
Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kam Rudolph Fischer infolge der Krankheitsfolgen in den Innendienst nach Vortex, Philadelphia. Er nahm die schon zusammengesammelten Einzelteile mit. Nach vielen misslungenen Versuchen, die Decke der Geige zu formen, fand er irgendwann das perfekte Stück Tannenholz, das besonders weich war, also gut die Schwingungen der Geige transportieren konnte und groß genug war, um die Decke aus einen Stück formen zu können.
„Aber zuerst musste ich mir mein Werkzeug bauen.“ Was sich gar nicht als so einfach erwies, da er auch hier immer wieder von Kontrollen gehindert wurde. „Haben sie spitzen Werkzeuge?“, erinnert er sich an die Amerikaner zurück und macht deren Akzent nach. Nur ein Soldat hätte einmal anders reagiert, nachdem er seine selbstgebaute Dekupiersäge entdeckte, die Fischer benötigte, um die Wirbel zu formen: „The best that I have seen.“
Auch ein Captain bekam mit, was Fischer vorhatte und war so begeistert von seinem Schaffen, dass er ihm half, einen Steg, Saiten, eine Kinnstütze und einen Bogen zu besorgen.
Und dann hatte er es geschafft: Sie war spielfertig. Und sein Freund aus der Küche, Franz Schiffels, durfte sie spielen.
„Ich habe wirklich versucht, auf alles zu achten!“ Die Geige, die ich mir von allen Seiten genau anschaue, sieht wirklich nicht aus wie eine billige Imitation, die man erwarten würde, wenn man hörte „Der hat ´ne Geige gebastelt, als er in Kriegsgefangenschaft war“. Die Krümmung der Zargen stimmt genau; die Wölbung der Decke ist gelungen sowie auch die des Bodens. Alles scheint genauso zu sein, wie es soll, damit die Schallwellen sich entfalten können. Die Geige in den Händen haltend betrachtet er sein Meisterstück. Dann nimmt er meine Geige in die Hand: „Die F-Löcher sind nicht gelungen.“ Ich schaue mir beide Instrumente an, seine Geige und meine, und verstehe nicht, was er meint. „Ich habe die Krümmung zu weit gemacht“, und er zeigt es mir: Die Rundung des unteren F-Bogens geht zu weit herum, sodass die Gefahr, dass etwas abbricht, größer ist. Aber mir - und ich habe schon viele verschiedenste Geigen gesehen - ist dieser kleine Schönheitsfehler nicht aufgefallen.
Inzwischen sind wir im Herbst 1946 angekommen, sehr chronologisch erzählt Rudolph Fischer seine Geschichte weiter. Das Gerücht machte sich breit, es ginge zurück nach Hause. Da er genau wusste, dass er niemals an den Kontrollen vorbei käme mit seinem Instrument, schickte er seine Geige mit dem Internationalen Rote Kreuz in die Schweiz. Von da aus ging es weiter nach München. Er hatte einen Freund kontaktiert, der solange auf sein Meisterstück aufpassen sollte, bis er sie holen konnte.
Zurück in Deutschland angekommen, ging es wieder in ein Strafgefangenenlager, diesmal nach Frankfurt; die Soldaten warfen ihm vor, er sei ein Nazi, von der SS. Dort blieb er jedoch nicht lange und wurde wieder freigelassen. Er hatte die Information, dass seine Eltern aus dem Sudetenland in die DDR ausgesiedelt seien. Also ging es Weihnachten 1947 heimlich über die Grenze. Und da blieb er bis 1949/50 und arbeitete in einer Autowerkstatt als Autoschlosser und überholte Motoren - und holte die Geige aus München zu sich.
Die Wut über die Aussichtslosigkeit seiner eintönigen Arbeit an den Autos hielt Fischer aber nicht dort. So landete er 1951 – vorerst ohne Geige - in Wipperfürth, westlich von Köln, in einer Flüchtlingsbaracke. Er fand jedoch bald ein richtiges Zimmer und Arbeit und lernte Doris kennen, die er im August 1954 heiratete. Er baute sich eine eigene Werkstatt auf und machte sich sein schon in Amerika bewundertes Geschick zum Beruf, er baute und reparierte Holzwerkzeuge und arbeitete auch mit Holz. Fehlte also nur noch eins: die Geige!
Erst 1962 besuchten das junge Paar mit dem damals gerade sechs Jahre alten Sohn Peter wieder die Eltern in der DDR. Die Geige ohne Probleme am Zoll vorbeizubekommen war natürlich nicht möglich. Man brauchte ein Zertifikat eines Musikhauses, das den Wert des Instrument nicht höher als 10 DM schätzte. Die Geige wurde jedoch für wertvoller gehalten, was die Übersiedlung des emotional so wertvollen Instruments schwierig machte. Aber Rudolph und Doris hatten eine Idee. Sie packten die Geige in den Koffer des kleinen Peter.
Und der Plan schien auch aufzugehen. Die Zollbeamten schauten die Koffer der Eltern durch, der notdürftig mit einer Kordel zusammen gehalten wurde, da er auf der Hinreise kaputtgegangen war. Den kleinen Peter winkten sie ohne Kontrolle durch. Aber Peter beschwerte sich im kindlichen Trotz: „Aber mein Koffer ist doch noch nicht kontrolliert!“ Der Zollbeamte wirkte genervt, woraufhin Doris vorschlug, wenigstens den Rucksack des Jungen durchzugucken. Darauf ließ sich der Beamte ein und es war geschafft! Die Geige war über der Grenze und endlich in Sicherheit. Jetzt war sie da, wo sie hin gehörte: bei Rudolph Fischer. Und hier, in Wipperfürth, ist sie auch heute noch. Sie liegt im Wohnzimmer auf einem Schrank, wird regelmäßig von Doris in den Händen gehalten und erinnert an die Geschichte ihres Mannes, denn spielen können die Geige beide bis heute nicht.
(2017)